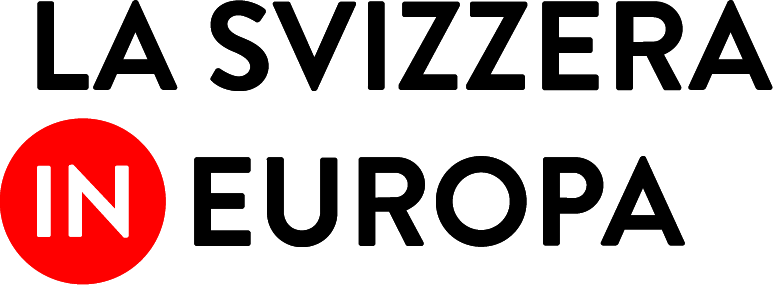Wie Fachidioten Europa zu Tode reden
Zum Interview mit Gabriel Felbermayr in der NZZ vom 6. Juli 2019
von Silvio Arioli, 10. Juli 2019
Zugegeben, Felbermayr für sein Interview als Fachidioten zu bezeichnen, ist verfehlt. Er ist zweifellos ein ausgewiesener Oekonom, der aus der Sicht seines Faches politisch Relevantes zu sagen hat. Aber sein Interview liefert einige treffliche Beispiele, wie fachlich durchaus begründete Beurteilungen zu politischen Fehlschlüssen führen, wenn sie nicht mit den nötigen Vorbehalten einer rein fachlichen Betrachtungsweise geäussert werden.
Beispiel Freizügigkeit: „Zu sagen, es gibt nur vier Freiheiten oder gar keine, ist Unsinn.“ Das ist ökonomisch gesehen zweifellos richtig und eigentlich trivial. Aber es ist genauso unsinnig zu sagen, die drei Freiheiten gehören wegen ihrer ökonomischen Effizienz zusammen, während die Personenfreizügigkeit in das Belieben der Teilnehmer gestellt werden kann.
In ökonomischer Sicht belegen die letzten siebzig Jahre, dass jeder Liberalisierungsschritt für sich grundsätzlich effizienzsteigernd wirkt und nicht zwangsläufig mit weiteren Liberalisierungsmassnahmen verbunden ist. Das fängt an mit den Zollsenkungen und der schrittweisen Beseitigung mengenmässiger Beschränkungen in den fünfziger und sechziger Jahren an und setzt sich fort in den Bemühungen um die Beseitigung nichttarifärer Handelshemmnisse und die Liberalisierung der Dienstleistungen. Bemerkenswert ist, dass die Liberalisierung dieser Bereiche grösstenteils nur auf dem Weg der Rechtsharmonisierung möglich ist. Diese ist in grösserem Umfang nur mit supranationalen Institutionen zu verwirklichen. Deshalb liegen Welten zwischen den in der EU einerseits und in der WTO oder in Freihandelsabkommen andererseits erreichten Liberalisierungen.
In politischer Sicht zeigt ein Blick auf die Geschichte der EU, dass diese nie zustande gekommen wäre und die Süd- und Osterweiterung nicht realisierbar gewesen wären, wenn man nur auf insgesamt erzielbare Effizienzgewinne abgestellt hätte. Schon die Gründung war nur möglich, indem die wirtschaftlich gebotene Zollunion mit der wirtschaftlich fragwürdigen Agrarunion verbunden wurde, weil sich Frankreich sonst zu sehr als Verlierer gesehen hätte. Für die Süd- und Ostländer war die mit dem Beitritt verbundene Marktöffnung nur tragbar, wenn ihnen substantielle Transferzahlungen und – nach zeitlich begrenzten Uebergangsfristen – die volle Personenfreizügigkeit gewährt wurden.
Der Vorschlag von F., die wirtschaftliche von der politischen Integration zu trennen und die ausschliesslich wirtschaftliche Integration auch Ländern anzubieten, die – wie Grossbritannien oder die Schweiz – eine wirtschaftliche aber keine politische Integration wollen, ist deshalb untauglich. Ganz abgesehen davon, dass etwa die Schweiz selbst die wirtschaftliche Integration nur in von ihr ausgewählten Sektoren will und eine mit der wirtschaftlichen Integration zwangsläufig einhergehende gemeinsame Wettbewerbspolitik ablehnt. Auch die für den Brexit treibende Parole „take back control“ meint ausdrücklich alle, auch wirtschaftliche Entscheidungen.
Die Untauglichkeit des Vorschlags zeigt sich auch an mehreren, im Interview gegebenen Ausführungen zu einzelnen Tätigkeitsbereichen der EU.
Zuwanderung in die Sozialsysteme: „Die Kritik (an der Personenfreizügigkeit) gründet sich in Grossbritannien oder auch in der Schweiz vor allem an Letzterem (i.e. „am vollen Zugang in die Sozialsysteme“). Wenn die Migration durch die Grosszügigkeit des Sozialsystems ausgelöst wird, schafft dies keinen Mehrwert.“
Die NZZ hat in zahlreichen Berichten über Studien und eigenen Recherchen gezeigt, dass die Sozialsysteme kein Grund für eine nennenswerte innereuropäische Migration sind. In einem Artikel hat sie z.B. die Attraktivität des britischen Systems untersucht, das einen niedrigen Mindestlohn mit Fürsorgeleistungen zur Sicherung des Existenzminimums der Familienmitglieder kombiniert. Obwohl durch diese Kombination ein für Osteuropäer mit Familie vergleichsweise anständiges Einkommen erzielt wird, hält sich die Belastung der Fürsorge in tragbaren Grenzen, da die meisten Osteuropäer Arbeit finden, die besser als mit dem gesetzlichen Mindestlohn bezahlt wird.
In der Schweiz hat die Einwanderung auf Grund der Personenfreizügigkeit den Sozialversicherungen keine Mehrbelastung sondern Mehreinnahmen gebracht. Dass Zugewanderte überproportional Sozialfürsorge beanspruchen, ist dem Umstand zuzuschreiben, dass das schweizerische Einwanderungsrecht vor der Uebernahme der EU-Personenfreizügigkeit die Einwanderung gering Qualifizierter förderte, die in Branchen mit hoher Fluktuation und Arbeitslosigkeit tätig waren.
Harmonisierung des Sozial-, Arbeits- und Steuerrechts: „Politisch will die EU die Harmonisierung im Arbeits- und Sozialbereich ausdehnen…“ Von einem Willen der EU in diesem Bereich zu sprechen, ist nicht realistisch. Am von F. genannten Beispiel der Arbeitszeitregulierung erläutert: Die Arbeitszeitrichtlinie von 1993 war der ab und zu angewandte, wenig schöne Kompromiss: Man erliess eine Richtlinie, nach der die Mitgliedstaaten im Wesentlichen das tun konnten, was sie ohnehin tun wollten. Nach 2000 drängte das Parlament auf eine substantielle Revision. 2003 trat sie in Kraft. Damit wurden einige Lücken gefüllt, aber von einer Zentralisierung kann noch immer keine Rede sein. Die gleiche Methode wurde übrigens schon bei der
Festlegung des Mindestsatzes der Mehrwertsteuer angewandt, und Steuerfragen finden generell höchst selten die erforderliche Einstimmigkeit.
Subsidiaritätsprinzip: Dieses besagt nicht, „dass eine Aufgabe möglichst nahe heim Bürger anzusiedeln ist“, sondern, dass die Union nur tätig wird, “sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Massnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können…“ (Art. 5 Abs. 3 EUV). Effizienz in der Verwirklichung gemeinsamer Ziele macht das Subsidiaritätsprinzip der EU aus. Bürgernähe ist eine erwünschte Folge, aber nicht das Kriterium für die Kompetenzzuweisung.
„Wenn sich die zweitgrösste Volkswirtschaft der EU verabschiedet, die noch am ehesten ein Garant für die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips ist…verschieben sich die Machtverhältnisse gehörig. Das neue Europa wird noch zentralistischer sein, mit grösserer Gestaltungsmacht Brüssels.“
Es trifft zwar zu, dass die Briten zu den eifrigsten Verfechtern des Subsidiaritätsprinzips gehörten. Anzunehmen, dass die EU nach ihrem Austritt hoffnungslos der französischen Zentralisierungslust zum Opfer fällt, ist doch wohl weniger eine begründete Prognose als vielmehr die Beschwörung eines Gespenstes, das die europäische Gemeinschaft seit ihrer Gründung begleitet. Eine solche Aussage würde eine eingehende Analyse der Europapolitik der 27 Mitgliedstaaten voraussetzen, und diese würde höchstwahrscheinlich zum Schluss kommen, eine seriöse Prognose sei heute nicht möglich, weil keine Mehrheiten dafür auszumachen sind, ob, was und wie zentralisiert werden soll.
Ungeachtet solcher auf der Hand liegender Vorbehalte war die NZZ-Redaktion von der Aussage von F. so beeindruckt, dass sie diese zum Titel des ganzseitigen Interviews machte.
Landwirtschaftspolitik: „Wie hoch die Direktzahlungen an Bergbauern in Bayern oder Tirol sind, sollte den Regionen überlassen werden.“
Zum einen lässt F. unerwähnt, dass schon heute ein grosser Teil der Subventionen an die deutschen Bauern aus nationalen Kassen kommen. Wie gross dieser Anteil ist, ist schwierig zu erfassen und wurde m.W. nie untersucht. Zum anderen erweckt er den Eindruck, dass eine Agrarunion ohne zentrale Regelung der Landwirtschaftssubventionen möglich wäre und sich auf Produkte- und Produktionsvorschriften beschränken könnte, was zweifellos nicht der Fall ist.
Migrationspolitik gegenüber Drittländern: Auf die Frage, was sich abgesehen vom Euro in der EU ändern müsste, antwortet F.: „Die Staaten der Europäischen Union sollten ihre Aussengrenzen gemeinsam schützen. Es würde helfen, wenn Flamen, Bayern oder Tschechen am Abend in den Nachrichten am Fernsehen sähen, dass ihre Landsleute die Grenzen der EU in Rumänien oder Bulgarien bewachen.“
Difficile est satiram non scribere. Da soll das Vertrauen in eigene Grenzwächter einen wesentlichen Beitrag – für F. den einzig nennenswerten – zur Lösung des Migrationsproblems, dem für die EU neben dem Euro am schwersten wiegenden aktuellen Problem, leisten. Dabei wecken bulgarische oder rumänische Grenzwächter weniger wegen mangelnden Vertrauens in ihre Effizienz Bedenken als vielmehr wegen ihrer Brutalität gegenüber Migranten. Das eigentliche Problem liegt doch darin, wie die Migration in humanitär verantwortbarer Weise auf ein tragbares Ausmass begrenzt werden kann. Dazu reicht auch der beste Grenzschutz nicht aus, denn Land- und vor allem Seegrenzen lassen sich nicht abriegeln. Selbst dort, wo dies örtlich begrenzt einigermassen möglich ist, werden damit humanitär nicht verantwortbare Verhältnisse geschaffen. Das zeigen die Erfahrungen mit den spanischen Enklaven in Marrokko. Es braucht unabdingbar die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern und diese hat sich bisher als unvergleichlich viel schwieriger erwiesen als der Aufbau des gemeinsamen Grenzschutzes.
Alles in allem: Schade, F. hätte viel darüber zu sagen, wie die internationalen Wirtschaftsbeziehungen im Allgemeinen und der EU-Binnenmarkt im Besonderen auszugestalten sind. Stattdessen liefert er ein weiteres Beispiel der in der Europadebatte im Uebermass produzierten Medienbeiträge von Wissenschaftlern, die im Glanz ihrer wissenschaftlichen Reputation Ratschläge erteilen, die wissenschaftlich nicht zu begründen sind und damit mehr Verwirrung stiften als zur Klärung beitragen.