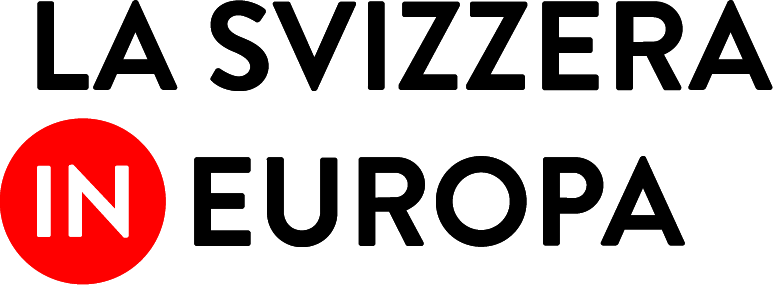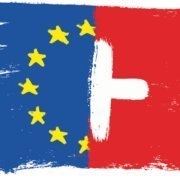Schweizerische Europapolitik: Hektische Stagnation von Daniel Woker
Im neuesten Bericht zu den Diplomatischen Dokumenten der Schweiz (Dodis), nach einer Sperrfrist von 30 Jahren freigegeben am 1. Januar 2024, wird das Jahr 1993 beleuchtet. Hauptthema war damals und bleibt heute das Verhältnis der Schweiz zur EU. Auch andere aussenpolitische Realitäten sind seither unverändert geblieben.
Seit der knappen, aber negativen Volksabstimmung über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) von 1992 ist das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU zerrüttet. Die danach abgeschlossenen bilateralen Abkommen I und II sind ein Heftpflaster, das der Schweiz einen Notzugang zum europäischen Binnenmarkt erlaubt. Die nie genesene Wunde muss nun neu durch die Bilateralen III verarztet werden. Es ist ein Lichtblick, dass die Weiterführung des Zugangs zum Binnenmarkt sowohl von Seiten der EU als auch der Schweiz positiv beurteilt wird. Gemäss einer kürzlich veröffentlichen Umfrage will eine klare Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer ein geordnetes Verhältnis mit der EU. Offen bleibt die Wunde, da in zahlreichen anderen gesamteuropäischen Belangen – Klimaschutz, Regelung von Zukunftstechnologien, Sicherheitspolitik insbesondere mit einem möglichen neuerlichen Präsidenten Donald Trump in Washington – die Schweiz nicht an Entscheidungsfindung und Beschlussfassung der EU beteiligt ist. Ihr bleibt nolens volens nur der Nachvollzug.
1993: Europäischer Optimismus trotz allem
Trotz dem deprimierenden Nein zum EWR Ende 1992 – am berühmte Dimanche Noir des damaligen Bundesrates Jean-Pascal Delamuraz – blieb die Landesregierung auch im unmittelbaren Nachgang dazu optimistisch, dass die folgende Epoche mit einem bilateralen Zugang zur damaligen EG (Europäische Gemeinschaft) ein kurzzeitiges Provisorium bleiben würde. Dies vor einem definitiven Entscheid, ob voller Beitritt zur EG oder doch ein zweiter Anlauf zum EWR. 1993 signalisierte der Bundesrat im aussenpolitischen Bericht, dass ein Beitritt «noch in diesem Jahrhundert» wahrscheinlich sei.
Das wurde damals auch an bilateralen Treffen mit den Chefs der wichtigsten Partnerländer so dargelegt. Das förderte deren Entgegenkommen, der Schweiz die Extrawurst eines vorläufigen bilateralen Zugangs zum europäischen Binnenmarkt zu erlauben. So wird der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl im Dodis-Bericht mit dem Zitat erwähnt «Schweizer Trotz hilft auf die Dauer nichts». Und auch der frühere französische Staatspräsident François Mitterrand liess sich überzeugen, dass die Schweiz in ihrem eigenen Interesse bald der EG beitreten würde, wie sich das für die übrigen europäischen Neutralen Österreich, Schweden und Finnland damals abzeichnete.
Auf konservativen Nationalismus eingeschwenkt
Wie man nun weiss, trat dies leider nicht ein. Vielmehr folgten 30 Jahre hektischer Stagnation in der schweizerischen Europapolitik. Diese kaprizierte sich primär darauf, möglichst viele bilaterale Vorteile zu erreichen, ohne bleibende Verpflichtungen übernehmen zu müssen. Auch wenn 2024 mit den Bilateralen III eine weitere provisorische Lösung gefunden werden sollte, ist emotionslos festzustellen, dass die Schweiz in den vergangenen 30 Jahren im Verhältnis zur EU auf einen Kurs des konservativem Nationalismus eingeschwenkt ist.
Der von Blochers SVP 1992 mit ihrer Schmutzpropaganda gegen Europa – «Brüssel als moderner Habsburger Drache, der die wehrhafte Schweiz verschlingen will» – eingeleitete Prozess hatte ungeahnten Erfolg über weite Teile der politischen Schweiz hinweg. Er führte zu einem generellen Rechtsruck auch links von der Schweizerischen Volkspartei. Hatte die FDP Anfang der 90er-Jahre den EG-Beitritt noch in ihrem Parteiprogramm, so meinte der Präsident der Jungen (!) FDP in einer öffentlichen Diskussion kürzlich im Brustton der Überzeugung eines Zürcher Bahnhofstrasse-Liberalen «Beitritt der Schweiz zur EU: nie».
Kein europäisches Bewusstsein vorhanden
Dies ist umso kurzsichtiger, als spätestens seit dem kürzlichen Entscheid der EU mit Kiew Beitrittsverhandlungen aufzunehmen, die Ukraine ein unverzichtbarer Teil von Europa geworden ist. Die schweizerische Ukrainepolitik ist also damit ebenfalls Teil unserer Europapolitik. Auch hier ist heutzutage nichts von einem europäischen Bewusstsein der Schweiz auszumachen. Es herrscht primär Verweigerung: keine Waffenlieferungen wegen dem Neutralitätsdogma, keine Finanzhilfe wegen der Schuldenbremse und der konservativen Nationalbank und auch keine schweizerische Friedensvermittlung, die offensichtlich nicht gefragt ist. Der Lichtblick besteht hier in der Absicht des Auswärtigen Departements, über zehn Jahre sechs Milliarden Franken Wiederaufbauhilfe zu leisten. Aber auch diese Geste ist mit Schatten behaftet, sollte diese Summe zulasten der Unterstützung des globalen Südens gehen.
Europäisches Bewusstsein wäre hier einmal angezeigt, weil auch uns wohl geneigte internationale Beobachter der schweizerischen Ukrainepolitik mit Unverständnis und Kritik begegnen. So etwa der ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck, das verkörperte Gewissen Deutschlands, in einem Jahreswechsel-Gespräch in den Tamedia-Zeitungen. Er sieht mehr Solidarität mit der von Wladimir Putins Aggression schwer geprüften Ukraine als Jahrhundertaufgabe Europas an.
Sicherheitspolitik: Mehr Nato und EU notwendig
Aber auch im ureigenen Interesse unseres Landes sind grössere europäische Anstrengungen der Schweiz dringend nötig. So beispielsweise in der Sicherheitspolitik. Wie von Verteidigungsministerin Viola Amherd eben betont – und vom neu ernannten Staatssekretär im VBS, Brigadier Markus Mäder nachdrücklich unterstrichen –, wird die massive Erhöhung des schweizerischen Wehrbudgets, um sinnvoll zu sein, auch engere und mehr Zusammenarbeit mit der Nato und der sicherheitspolitischen EU mit sich bringen. Um in beiden Organisationen ernst genommen zu werden, muss die Jungfrau Helvetia von der unbefleckten (Neutralitäts-)Empfängnis abrücken und schönen Worten Taten zu Gunsten der Ukraine folgen lassen, dem gegenwärtig dringendsten Brennpunkt von Nato und EU.
Auch hier kontrastiert die ergebnisorientierte, offene Politik von Anfang der 1990er-Jahre mit der gegenwärtigen Neutralitätsängstlichkeit. Wie im Dodis- Bericht nachzulesen ist, erlaubte der Bundesrat damals im Rahmen der primär serbischen Aggression in Bosnien-Herzegowina ein erstes Mal militärische Überflüge der Nato über die Schweiz – «neutrality be damned».
Gute Dienste trotz Neutralität nicht gefragt
Neutralitäts-Fetischisten verweisen gerne auf die angeblich nur wegen der Neutralität möglichen Guten Dienste der Schweiz, im Sinne einer geschichtlichen, unverrückbaren Realität. Die Dodis-Dokumente von 1993 gehen auch auf die damalige Nahostpolitik des Bundesrates ein, mit Berichten über Kontakte mit Israel ebenso wie mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO); dies aber immer im Rahmen der damals dominanten Verträge von Oslo. Die wichtigsten im Spannungsfeld Nahost je geführten Verhandlungen fanden unter der Ägide der USA in der Hauptstadt des Nato-Mitglieds Norwegen statt und nicht im internationalen Begegnungsort Genf in der neutralen Schweiz.
Dies entspricht einem im Dodis-Bericht erwähnten Résumé des damals als schweizerischer Botschafter in Washington abtretenden Edouard Brunner, der ausdrücklich festhielt, dass die USA seit Ende des Kalten Krieges ihr Interesse an der schweizerischen Neutralität verloren hätten.
Heute steht mit Blick auf den Nahen Osten mit der Aktualität des Krieges zwischen der palästinensischen Terrororganisation Hamas und Israel das Mittun der Schweiz im Uno-Sicherheitsrat im Mittelpunkt. Die Schweiz hat sich in New York im Rahmen ihrer Möglichkeiten bislang gut geschlagen. Positiv ist insbesondere, dass sich so die aussenpolitische Diskussion in der Schweiz – und damit ein entsprechendes Bewusstsein hierzulande – verstärkt hat. Das Bewusstsein nämlich, was ein mittelgrosser europäischer Staat angesichts zunehmender Schwerpunktverlagerung von Europa weg auf der globalen Bühne ausrichten kann und – vor allem – was nicht. Insbesondere, wenn ihm das spezifisch schweizerische Handicap anhaftet, nicht an den zwei Strukturen EU und Nato teilzuhaben, die global für ein starkes Europa stehen.
Im Nahen Osten wird weiterhin eine schweizerische Vermittlung von den Konfliktparteien offenbar nicht nachgefragt. Das lässt deren konstantes Anbieten eigenartig erscheinen. Genf und das Weltwirtschaftsforum in Davos sind internationale Treffpunkte, welche mit spezifisch schweizerischer Leistung nur mehr wenig zu tun haben.
Wenn Innenpolitik die Aussenpolitik dominiert
Schliesslich werfen auch institutionelle Probleme Schatten auf die schweizerische Aussenpolitik. Entgegen einem oft gehörten Bonmot ist nicht alle Aussenpolitik auch Innenpolitik, sondern gerade umgekehrt: Dominiert die Innenpolitik die Aussenpolitik, wird letztere zur Mühsal und Peinlichkeit. Beispielhaft steht dafür etwa die kleinliche innerschweizerische Diskussion über die Spesenentschädigung für entsandte ausländische Arbeitnehmer zu einem Zeitpunkt, wo in Brüssel um Unterstützung für die Ukraine und damit um die Antwort auf die Schicksalsfrage nach der Zukunft der Demokratie in Europa gerungen wird.
Dem dabei aktiv als europäische Abrissbirne tätigen und dem russischen Autokraten und Kriegsherrn Wladimir Putin zudienenden ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban haben rechtskonservative Kreise, angeführt von Blochers SVP, kürzlich in Zürich zugejubelt. Ausgerechnet die zwei Vertreter dieser Partei im Bundesrat – Guy Parmelin und Albert Rösti – sind mit zentralen Dossiers in den bilateralen Verhandlungen Berns mit Brüssel betraut. Werden Sie über den Schatten ihrer Parteidoktrin, die grundsätzlich zu allem, was mit der EU zu tun hat, nein sagt, springen wollen, springen können?
Auch die Hausaufgaben müssen gemacht werden von Martin Gollmer
Der Bundesrat hat den Entwurf des Verhandlungsmandats für ein neues bilaterales Vertragspaket mit der EU verabschiedet. Damit ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des gestörten Verhältnisses zwischen der Schweiz und der EU getan. Gleichwohl dürften die kommenden Verhandlungen mit der EU-Kommission schwierig werden – vor allem aus schweizerisch-innenpolitischen Gründen.
Das Positive vorneweg: Die Schweiz will mit der EU über ein neues bilaterales Vertragspaket verhandeln. Das ist klar, nachdem der Bundesrat am Freitag, 15. Dezember, den Entwurf eines entsprechenden Verhandlungsmandats verabschiedet hat. Zweieinhalb Jahre nach dem Abbruch der Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen mit der EU und eineinhalb Jahr nach dem Beginn von Sondierungsgesprächen mit der EU über ein neues Vertragspaket ist das eine gute Nachricht. Endlich scheint es vorwärts zu gehen in den lange Zeit gestörten Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU.
Das Paket, das in der Öffentlichkeit den Namen «Bilaterale III» erhalten hat, umfasst unter anderem die Aktualisierung der fünf bestehenden Binnenmarktabkommen mit der EU zur Personenfreizügigkeit, zum Abbau technischer Handelshemmnisse, zum Land- und Luftverkehr sowie zur Landwirtschaft. Zudem sollen zwei neue Binnenmarktabkommen mit der EU abgeschlossen werden in den Bereichen Strom und Lebensmittelsicherheit. Auf den Gebieten Forschung, Bildung, und Gesundheit sieht das Paket schliesslich Kooperationsabkommen mit der EU vor. Der vom Bundesrat der EU vorgeschlagene Paketansatz der Bilateralen III ist breiter als es der Inhalt des gescheiterten Rahmenabkommens war. Damit soll in den Verhandlungen leichter ein Ausgleich der Interessen der beiden Seiten erreicht werden können.
In der Schweiz gibt es noch Widerstand
Trotzdem: Die Verhandlungen werden schwierig werden. Dies, obwohl man sich in den insgesamt elf Sondierungsgesprächen der Chefunterhändler der beiden Seiten sowie in 46 Gesprächen auf technischer Ebene in den trennenden Fragen näher gekommen ist und «Landezonen» für ungelöste Probleme definiert werden konnten. Die Gründe dafür liegen nicht zuletzt in der Schweiz. Innenpolitisch ist nämlich seit Beginn der Sondierungsgespräche mit der EU vor anderthalb Jahren noch nicht viel erreicht worden. Noch immer gibt es hierzulande erheblichen Widerstand gegen Teile der Festlegungen, die die Schweiz und die EU im Verlauf der bisherigen Gespräche gemacht haben. Teilweise dient der Widerstand gegen die Bilateralen III auch innenpolitischen Zielen, namentlich der Ausweitung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Gesamtarbeitsverträgen. Hier deshalb eine Übersicht der wichtigsten noch umstrittenen Punkte:
- Dynamische Rechtsübernahme: Die Schweiz soll EU-Recht in den Binnenmarktabkommen fortan dynamisch übernehmen, d.h. fortlaufend und nicht nur periodisch. Die Schweiz könnte dabei weiterhin selbständig entscheiden, ob sie EU-Recht übernehmen will. Auch bliebe der Rechtsweg gegen in schweizerische Gesetze übergeführtes EU-Recht bis zu einem allfälligen Referendum offen. Verweigert die Schweiz aber die Übernahme von EU-Recht, müsste sie mit Ausgleichsmassnahmen der EU rechnen.
- Streitbeilegung: Werden sich die Schweiz und die EU bei der Auslegung von EU-Recht in den Binnenmarktabkommen nicht einig, soll in letzter Instanz der Europäische Gerichtshof (EuGH), das oberste Gericht der EU, entscheiden. Dies aber erst, wenn zuvor eine Streitbeilegung in einem gemischten Ausschuss gescheitert ist und ein paritätisch besetztes Schiedsgericht den EuGH anruft.
Gegen diese beiden institutionellen Regelungen läuft vor allem die national-konservative Schweizerische Volkspartei (SVP) Sturm. Sie sieht die Souveränität der Schweiz bedroht und fürchtet, dass «fremde Richter» hierzulande Recht sprechen könnten. Der Milliardär Alfred Gantner, Gründer der Private-Equity-Firma Partners Group und Mitglied der EU-skeptischen Vereinigung «Kompass/Europa», erwägt diese institutionellen Regelungen mit einer Volksinitiative zu bekämpfen, wie er dem «SonntagsBlick» sagte.
- Lohnschutz: Aus der EU entsandte Arbeitnehmer sollen in der Schweiz für gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten wie hiesige Arbeitskräfte. Spesen müssten jedoch nur nach den Ansätzen des Heimatslandes und nicht nach den Gepflogenheiten des Gastlandes bezahlt werden. Damit würden dem Lohndumping Tür und Tor geöffnet, fürchten die schweizerischen Gewerkschaften und kämpfen deshalb gegen das Verhandlungspaket an. Immerhin lässt sich sagen, dass diese Spesenregelung gegen den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit verstösst und auch innerhalb der EU umstritten ist. Hier ist das letzte Wort noch kaum gesprochen. Verstösse gegen das Entsenderecht könnten von den schweizerischen Behörden mit Bussen geahndet werden. Um diese sicherzustellen, mussten ausländische Firmen, die Arbeitnehmer in die Schweiz entsenden, bisher generell eine Kaution hinterlegen. Neu sollen diese Kaution nur noch Firmen leisten müssen, die schon einmal straffällig geworden sind. Die Gewerkschaften sehen darin eine weitere Abschwächung des Lohnschutzes.
- Landverkehr: Die Schweiz soll den internationalen Schienenpersonenverkehr öffnen. Das heisst, dass künftig auch ausländische Bahnunternehmen eigenständig Bahnverbindungen in die Schweiz anbieten können. Bisher konnten sie dies nur in Kooperation mit den SBB. Ausländische Bahnunternehmen müssten aber die hiesigen Lohn- und Arbeitsbedingungen einhalten. Auch müssten sie den Taktfahrplan und die Tarife in der Schweiz (bspw. Generalabonnement und Halbtax-Abonnement) berücksichtigen. Die Gewerkschaften fürchten trotzdem eine Schwächung des hiesigen Service Public im öffentlichen Verkehr.
- Kohäsionszahlung: Die in den Sondierungsgesprächen besprochene Lösung sieht vor, dass ein rechtsverbindlicher Mechanismus für regelmässige Schweizer Beiträge zugunsten wirtschaftlich schwächerer EU-Mitgliedstaaten ausgehandelt werden soll. Die Ausgestaltung eines solchen Mechanismus wurde aber noch nicht definiert. Gleiches gilt für die Eckwerte des nächsten Schweizer Kohäsionsbeitrags, wie bspw. Dauer, Höhe, zu begünstigende Länder oder thematische Prioritäten. Wird die Rechnung für die Schweiz zu teuer, könnte in der Bevölkerung breiter Widerstand gegen das Verhandlungspaket entstehen.
Breite europapolitische Allianz vonnöten
In den anstehenden Verhandlungen auf die Bedenken der SVP Rücksicht zu nehmen, ist vergebene Mühe, auch wenn sie die mit Abstand wählerstärkste Partei in der Schweiz ist. Die SVP stemmt sich nämlich gegen jegliche Annäherung an die EU. Ob man den Gewerkschaften in den Verhandlungen entgegenkommen kann, ist fraglich, weil auch die EU ihre roten Linien hat. Vielleicht liessen sie sich mit einer Ausweitung der Gesamtarbeitsvertragspflicht in der Schweiz zum Einlenken bewegen. Aber dagegen wehrten sich bisher die Arbeitgeberverbände. Hier sind Bundesrat und Parlament gefordert.
Bleibt es beim Widerstand von SVP und Gewerkschaften, dürfte es schwierig werden das zukünftige Verhandlungsergebnis mit der EU durch eine allfällige Volksabstimmung zu bringen. Dies, obgleich sich in Umfragen stets über 60 Prozent für ein Abkommen und stabile Beziehungen mit der EU ausgesprochen haben und der taktische Widerstand der Gewerkschaften nicht überschätzt werden kann. Trotzdem bleibt es wichtig, dass sich schon jetzt eine möglichst breite Koalition der europapolitischen Vernunft zugunsten der Bilateralen III bildet. Dieser sollten alle Mitte-Links-Parteien inklusive der gewerkschaftsnahen SP sowie die Wirtschaftsverbände angehören. Nur dann wird das vom Bundesrat aufgegleiste Verhandlungspaket mit der EU vor dem Volk eine Chance haben.
Zwiespältige Bilanz der Wahlen 2023 aus europapolitischer Sicht von Martin Gollmer
Die Zusammensetzung des neuen Bundesparlaments steht nach den zweiten Wahlgängen für den Ständerat fest. Europapolitisch interessant ist, dass die EU-freundlichen Kräfte im Ständerat gestärkt wurden, im Nationalrat dagegen geschwächt. Die Fortsetzung des bilateralen Wegs mit der EU dürfte damit nicht einfacher werden.
Die Beziehungen zur EU sind das wichtigste ungelöste aussenpolitische Problem der Schweiz. Dennoch war es im Vorfeld der Wahlen 2023 ins eidgenössische Parlament seltsam abwesend. Die Parteien vermieden das Sujet im Wahlkampf tunlichst. Die EU-feindliche SVP hatte mit dem Schreckgespenst einer unkontrollierte Migration und einer 10-Millionen-Schweiz ein zugkräftigeres Thema gefunden. Die anderen, tendenziell EU-freundlichen Parteien griffen die in der Bevölkerung kontrovers diskutierten Beziehungen zur EU aus Angst vor Wählerverlusten nicht auf. Sie wollten von der wählerstarken national-konservativen SVP nicht als Euroturbos gebrandmarkt werden können.
Nun sind die Wahlen vorbei und die Beziehungen zur EU kommen wieder aufs Tapet. Bereits hat der Bundesrat angekündigt, bis Ende Dezember ein Mandat für Verhandlungen mit der EU über ein weiteres Vertragspaket namens Bilaterale III zu verabschieden. Danach soll das Mandat im Januar den aussenpolitischen Kommissionen der eidgenössischen Räte, den Kantonen und den Sozialpartnern zur Vernehmlassung weitergeleitet werden. Das endgültige Mandat dürfte dann im Verlauf des Februars feststehen. In der Folge könnten im März die Verhandlungen mit der EU beginnen.
Spätestens mit der Vernehmlassung im Januar sind verbindliche europapolitische Stellungnahmen der Parteien gefragt. Dann wird sich zeigen, wie sich die neuen Kräfteverhältnisse in National- und Ständerat auf die vom Bundesrat angestrebte Fortsetzung des bilateralen Wegs mit der EU auswirken. Was ist dabei vom neuen Bundesparlament zu erwarten?
Ständerat: Keine Chance für die Isolationisten
Zunächst zum Ständerat. Dort gingen in der Deutschschweiz die zweiten Wahlgänge vom Sonntag, 19. November 2023, allesamt zugunsten von Kandidatinnen und Kandidaten aus, die für geregelte Beziehungen zur EU eintreten. Tiana Moser (GLP) gewann in Zürich, Franziska Roth (SP) in Solothurn, Simon Stocker (SP) in Schaffhausen und Marianne Binder (Mitte) im Aargau. Die SVP- und SVP-nahen Herausforderer, die für eine isolationistische Schweiz stehen, hatten keine Chance.
Damit sind in der kleinen Kammer die tendenziell EU-freundlichen Kräfte gestärkt worden. Zu diesen gehören die Vertreterinnen und Vertreter der Mitte (15 Sitze), der FDP (11), der SP (9), der Grünen (3) und der GLP (1). Diese verfügen damit über 39 von insgesamt 46 Sitzen im Ständerat – eigentlich eine solide Mehrheit. Allerdings gibt es in einigen dieser Parteien etliche Abweichler von der EU-freundlichen Linie – bei der SP etwa die Vertreter der Gewerkschaften. Auch reicht der Konsens in dieser Koalition nicht über die Fortsetzung des bilateralen Wegs mit der EU hinaus. Ein zweiter Anlauf zu einem EWR-Beitritt fände gegenwärtig nur wenige Anhänger. Und kaum jemand würde sich zum jetzigen Zeitpunkt für einen EU-Beitritt stark machen.
Das Lager der EU-feindlichen Kräfte ging dagegen geschwächt aus den Ständeratswahlen hervor. Die Vertreterinnen und Vertreter der SVP (6 Sitze) sowie des rechtspopulistischen Mouvement Citoyens Genevois (MCG; 1) können deshalb zumindest eine Fortsetzung des bilateralen Wegs mit der EU nicht verhindern. Dies auch dann nicht, wenn sich zu ihnen noch Abweichler aus den tendenziell EU-freundlichen Parteien gesellen.
Nationalrat: EU-Mehrheit könnte schnell kippen
Die Ergebnisse zumindest der zweiten Wahlgänge für den Ständerat korrigieren zum Teil den Rechtsrutsch, der sich im Nationalrat einstellte. Dort gewann die SVP 9 Sitze und kommt nun auf insgesamt 62 Mandate. Rechnet man noch die Vertreterinnen und Vertreter der EDU (2), des MCG (2) und der Lega (1) dazu, die sich der SVP-Fraktion anschliessen wollen, sind es sogar 67 Sitze. Das ist damit die mit Abstand grösste Gruppe im 200-köpfigen Nationalrat. Die SVP wehrt sich traditionell gegen jeglichen Ausbau der Beziehungen der Schweiz zur EU. Doch trotz ihrer Stärke kann sie auch in der grossen Kammer die Fortsetzung des bilateralen Wegs allein nicht blockieren.
Findet die SVP aber Partner im Nationalrat oder ausserhalb, könnte die Mehrheit zugunsten der EU schnell einmal kippen. Im Vordergrund steht dabei vor allem die Asylpolitik – ein Dossier, das aufgrund der Dublin- und Schengen-Assoziierungsabkommen mit der EU ebenfalls europapolitischen Charakter hat. In diesem Bereich tritt aufgrund der verstärkten illegalen Migration nicht nur die SVP, sondern etwa auch die FDP (28 Mandate, -1) für Verschärfungen ein. Zusammen kommen die rechtsbürgerlichen Parteien auf 95 Sitze im Nationalrat. Zur Mehrheit fehlen damit noch 6 Stimmen. Und die lassen sich angesichts der Brisanz des Asyl- und Migrationsthemas etwa in der politischen Mitte leicht finden.
Einen starken Partner hat die SVP mit den Gewerkschaften auch in der Ablehnung der Personenfreizügigkeit mit der EU gefunden. Diese wehren sich vehement gegen eine Abschwächung des Lohnschutzes für Schweizer Arbeitnehmer. Zusammen könnten die beiden in einer Volksabstimmung die Fortsetzung des bilateralen Wegs torpedieren.
Die SVP macht auch Opposition gegen ein Stromabkommen mit der EU, das gemäss Bundesrat Teil der Bilateralen III sein soll. Mit einem solchen Abkommen würde sich die Schweiz weiter mit der EU verzahnen, das gefährde die Souveränität des Landes. Die Stromversorgung der Schweiz soll im Land selbst sichergestellt werden, fordert die Partei. Einer der beiden Männer der SVP im Bundesrat, Energieminister Albert Rösti, sagte in einem Zeitungsinterview, er sei für ein Stromabkommen, aber nicht um jeden Preis. Einer der Preise, den die EU in diesem Bereich fordert, ist die Liberalisierung des Strommarktes in der Schweiz. Das ist in der Bevölkerung nicht populär. Bereits haben die Gewerkschaften Widerstand gegen eine solche Liberalisierung angemeldet – selbst wenn es der Schweiz in den Verhandlungen mit der EU gelingen sollte, eine nur teilweise Öffnung des Strommarktes durchzusetzen. Da Marktliberalisierungen von linken Parteien kritisch gesehen werden, könnten sich auch diese dem Widerstand der Gewerkschaften und der SVP anschliessen.
Für die EU-freundlichen Kräfte verliefen die Nationalratswahlen enttäuschend. Die GLP, die als einzige Partei vorbehaltlos für das gescheiterte institutionelle Rahmenabkommen mit der EU eingetreten war, verlor mit 6 Sitze und kommt jetzt noch auf 10 Mandate in der grossen Kammer. Die Grünen, die zusammen mit der Operation Libero eine Europa-Initiative lancieren wollen, büssten 5 Sitze ein und haben neu nur noch 23 Vertreterinnen und Vertreter im Nationalrat. Einen Mandatsverlust gab es auch für die EVP (-1 auf 2 Sitze). Verbessern konnten sich dagegen – allerdings nur leicht – die SP (+2 auf 41 Sitze) und die Mitte (+1 auf 29 Sitze).