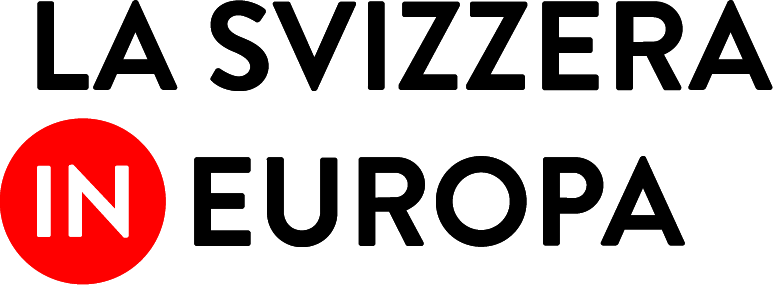Europa hat die Wahlen in der Schweiz verloren – oder doch nicht ganz? Von Thomas Cottier
Die EU-feindliche SVP legt im Nationalrat deutlich Sitze zu, die EU-freundliche GLP büsst mehrere Mandate ein. Das zeigt: Europa hat die Wahlen 2023 ins eidgenössische Parlament verloren. Umso wichtiger ist deshalb jetzt, dass alle politischen Kräfte diesseits der SVP eine Allianz der europäischen Vernunft schliessen.
Die Bemühungen um ein geregeltes Verhältnis zur Europäischen Union (EU) gehören klar zu den Verlierern der National- und Ständeratswahlen vom 22. Oktober 2023. Die Schweizerische Volkspartei (SVP/UDC), die weitere Integrationsschritte kategorisch ablehnt, hat ihren Wähleranteil im Nationalrat auf 27.9 Prozent erhöht und ist fortan mit 61 Sitzen im Nationalrat vertreten; die Ergebnisse im Ständerat sind noch offen. Die Partei konnte sich auf Kosten nicht stimmberechtigter Personen mit dem Thema und dem Feindbild Migration durchsetzen. Sie sieht sich in ihrer EU-feindlichen Haltung und ihrer Betonung nationaler Souveränität bestätigt. Die Grünliberale Partei (GLP/VLS), die sich als einzige für den Rahmenvertrag mit der EU eingesetzt hat, fällt auf 7.6 Prozent Prozent zurück und verliert 6 von 16 Sitzen im Nationalrat. Die Grünen (les Vert-e-s), die sich für eine starke Klimapolitik einsetzen, büssen 8.4 Prozent Wähleranteil ein und kommen noch auf 9.8 Prozent im Nationalrat. Sie fallen von 28 auf 23 Sitze zurück.
Alle Parteien, auch der Freisinn (FDP/PLR) mit 14.3 Prozent und 28 Sitzen, die Sozialdemokraten (SP/PS) mit 18.3 Prozent und 41 Sitzen sowie die Mitte (le Centre) neu mit 14.1 Prozent und 29 Sitzen im Nationalrat, haben das Thema Europa und die Beziehungen zur EU im Wahlkampf tunlichst vermieden. Die Frage ist müssig, ob das den Ausgang angesichts dringenderer Probleme namentlich bei der GLP und den Grünen verändert hätte. Interessanter ist die Frage, wie sich die verdrängten europapolitischen Herausforderungen in der kommenden Legislatur auswirken werden.
Es braucht internationale Zusammenarbeit
Die SVP wird vorerst selbstbewusst auf eine restriktivere Einwanderungspolitik drängen. Sie wird erneut die Umsetzung der 2014 knapp gewonnenen Masseneinwanderungsinitiative und damit von Artikel 121a der Bundesverfassung zur Arbeitsmigration einfordern. Sie wird Kontrollen an der Grenze und abschreckende Massnahmen gegen asylsuchende Wirtschaftsflüchtlinge verlangen. Im Einklang mit ihrer nationalkonservativen Ausrichtung und Ideologie wird sie autonome Massnahmen der Schweiz vorschlagen. Sie wird dabei bald feststellen müssen, dass all die Fragen der Migration nicht im Alleingang gelöst werden können. Dieser führt in die Sackgasse.
Die Abschiebung und Rückweisung von Flüchtenden in die Nachbarstaaten wird zu harschen Reaktionen und Vergeltungsmassnahmen führen, zumal Rückführungsverträge schwierig umzusetzen sind. Es bedarf der Solidarität und geregelter Verfahren mit der EU, es sei denn die SVP schlage die Errichtung von Internierungslagern vor. Weltweit wird die Klimamigration zunehmen und auch an den Schweizer Grenzen nicht haltmachen. Lösungen können auch hier nur mit der EU und in internationaler Zusammenarbeit gefunden werden.
Die Kündigung der Freizügigkeit und Einführung eines Punktesystems sowie von Kontingenten wird den Bedarf an Fachkräften nur mit grossen bürokratischem Aufwand seitens der Unternehmen sicherstellen können. Und gut qualifizierte Kräfte wollen ihre Familie mitnehmen, so dass das Ziel einer effektiven Beschränkung gegenüber dem heute in Europa freien Markt in der Praxis angesichts hier rückläufiger Geburtenraten kaum erreicht werden kann. Die ablehnende Haltung gegenüber ausserfamiliärer Kinderbetreuung wird das Problem des Fachkräftemangels weiter verschärfen. Die Erosion der bilateralen Verträge setzt die Industrie zusätzlich unter Druck, und mit dem einstweiligen Ausschluss der Schweiz aus der Forschungszusammenarbeit mit der EU verliert unser Land ihre besten Nachwuchskräfte in der Wissenschaft.
Autarkie ist keine tragfähige Lösung
Das gleiche gilt für die Sicherheitspolitik. Die nationale Sicherheit kann nicht im Alleingang mit der Aufrüstung der Schweizer Armee erzielt werden. Es genügt nicht, allein an der Grenze zu stehen und auf die nationale Souveränität und integrale Neutralität zu pochen. Die Rüstung kann autonom nicht finanziert werden und ist auf zuverlässige Kooperation mit den EU- und den Nato-Staaten angewiesen. Die heutigen Bedrohungen verlangen eine enge internationale Zusammenarbeit.
Das gleiche gilt für die Versorgung. Die Versorgung mit Energie kann nicht im Alleingang bewältigt werden, es sei denn die Wähler nehmen massiv höhere Kosten für notabene vermehrt fossil produzierten Strom in Kauf. Das Stromabkommen bleibt unabhängig der Wählergunst notwendig. Kommt es nicht, werden dies die Leute mit dem Portemonnaie, allenfalls auch mit Blackouts bezahlen. Sicherheit ist anders. Eine abgeschottete Landwirtschaft ist ebenfalls mit hohen Kosten verbunden und vermag im Fall eines klimabedingten Ernteausfalles das Land nicht annährend zu versorgen. Autarkie ist auch hier keine tragfähige Antwort.
SVP wird Verantwortung übernehmen müssen
Die SVP wird in all diesen Fragen Verantwortung übernehmen müssen. Sie wird ihre Wahlversprechen nur umsetzen können, wenn sie der Zusammenarbeit mit der EU zustimmt – in Fragen der Migration, der Klimapolitik und der Sicherheitspolitik, hier auch mit der Nato. Sie wird ihre Vorstellungen der nationalen Souveränität und Neutralität überdenken müssen. All die aufgestauten und verdrängten Probleme werden sich sonst weiter verschärfen. Bleiben sie ungelöst, hinterlassen sie enttäuschte und frustrierte WechselwählerInnen. Die heute verdrängte Europafrage wird dann unter Druck mit Bestimmtheit die Wahlen 2027 dominieren. Es liegt daher im Interesse gerade der SVP, tragfähige Lösungen schon vorher einzufahren. Auch die nächsten Wahlen werden über das Portemonnaie entschieden.
Aufgabe und Chance all der anderen Parteien mit ihrer grossen Mehrheit ist es, den Druck der verdrängten Probleme zu nutzen und nun eine Allianz der europäischen Vernunft zu schliessen. Sie gewinnen alle, wenn sie sich zusammenraufen und am gleichen Strick ziehen. Die Europafrage ist in dieser Legislatur Schlüssel nicht nur für die Erreichung der Klimaziele, sondern auch für die sozialen Anliegen der SP und der Grünen. Die Lebensmittelkosten, die Gesundheitskosten lassen sich ohne Abkommen mit der EU und mehr Wettbewerb nicht senken. Die FDP und GLP können hier ihren Beitrag leisten zur Stärkung des Schweizer Standortes. Die Gewerkschaften müssen einsehen, dass die nur Dank der SVP mögliche sture Haltung zum Lohnschutz zu viel Kollateralschaden verursacht. Sie trägt zur Erosion des Werkplatzes Schweiz bei und gefährdet zahlreiche Stellen im Land. Sie verspielt Chancen zu Gunsten einer prosperierenden Wirtschaft, die in innovativen Branchen neue Jobs schafft. Und der Mitte kommt das Vorrecht zu, in der nächsten Legislatur als Zünglein an der Waage zu entscheiden und sich für die oder eine andere Lösung einzusetzen. Alle aber müssen aus sachlichen Gründen in die richtige Richtung nach Europa gehen. Polen hat es uns mit seinen Wahlen vom 15. Oktober 2023 vorgemacht.
EU-Sanktionen ignoriert – die Schweiz schadet sich selbst von Daniel Woker
Die Nichtteilnahme der Schweiz an Sanktionen der EU gegen Personen und Unternehmen aus Unrechtsstaaten wie China, Russland und Nordkorea ist ethisch inakzeptabel, wirtschaftspolitisch höchstens kurzfristig nützlich, sicherheits- und europapolitisch falsch und für das internationale Ansehen der Schweiz verheerend.
Dank unabhängigen schweizerischen Medien wie der Neuen Zürcher Zeitung und dem Tages-Anzeiger ist ein veritabler Skandal aufgedeckt worden: Laut offiziell bestätigten Berichten hat der Bundesrat bereits vor rund zehn Monaten und ohne Orientierung der Öffentlichkeit beschlossen, eine rund 1000-seitige Liste der EU mit Hunderten von überführten Straftätern aus Unrechtsstaaten zu ignorieren. Diese haben sich gravierender Verbrechen im Bereich der Menschenrechte, des Terrorismus, der chemischen Kampfstoffe und der Cyberkriminalität schuldig gemacht.
Ein Beispiel daraus sind Chinesen, die individuell für genozid-ähnliche – dieser Wortlaut stammt aus einem Bericht der UNO-Menschenrechtskommission, der die Schweiz angehört – Straftaten gegen ihre uigurische Minderheit verantwortlich sind. Sie werden dafür von den EU-Staaten mit Sanktionen belegt. Der Entscheid des Bundesrates, hier nicht mitzutun, ist offensichtlich ethisch inakzeptabel, was keiner weiteren Erklärung bedarf, aber auch kurzsichtig, weil er für die Schweiz nur Nachteile bringt.
Aus Rücksicht auf Wirtschaft und Neutralität
Wirtschaftsinteressen und Neutralität werden von den zuständigen Bundesbehörden angegeben, um den Entscheid zu rechtfertigen. Jedoch ist die schweizerische Neutralität völkerrechtlich überholt, findet im westlichen Ausland keine Anerkennung mehr und existiert nur noch als helvetische Trutzburg. Eine wichtige Rolle bei diesem Entscheid haben offensichtlich Interventionen der chinesischen Regierung gespielt, die Konsequenzen für die schweizerische Wirtschaft androhen. Soweit sind wir also: Wilhelm Tell’s Söhne kuschen vor dem Drachen aus Peking.
Dies ist nicht nur beschämend, sondern mittel- und längerfristig auch nutzlos. Denn die schweizerische Wirtschaft ist so eng mit den westlichen Partnerländern verflochten, dass in Deutschland oder den USA verhängte Sanktionen auch von schweizerischen Unternehmen vollzogen werden müssen – sei es als Tochter oder als Besitzer der betroffenen Firmen in Industrie und Dienstleistung oder auch nur wegen Abwicklung eines Geschäftes in Dollar. Soviel sollte man eigentlich aus den zahlreichen Affären etwa in der helvetischen Finanzwirtschaft gelernt haben.
Das Freihandelsabkommen der Schweiz mit China (FTA) – das bei Teilnahme Berns an den Sanktionen allenfalls von Beijing in Frage gestellt werden könnte – bietet höchstens temporäre Vorteile. Falls die EU ihrerseits mit China ein FTA oder ähnlich abschliesst, ist das schweizerische Pendant überholt. Falls dies nicht eintreffen sollte, wird Brüssel kaum zusehen, wie aus der Schweiz heraus operierende Wirtschaftsakteure gegenüber EU-Mitgliedern dauerhaft bevorteilt würden.
Kontraproduktiv für Sicherheits- und Europapolitik
Ausser bei der SVP und bei auf dem anderen politischen Flügel naiven Pazifisten hat in der schweizerischen Politik mit dem Ukrainekrieg ein sicherheitspolitisches Umdenken eingesetzt: Eine engere militärische Zusammenarbeit mit NATO und auch EU wird im Rahmen erhöhter Leistungen für die Landesverteidigung für unverzichtbar angesehen. Die Schweiz ist hier weitgehend Bittsteller und auf das Wohlwollen westlicher Partnerländer angewiesen. Keine Sanktionen gegen bekannte Terroristen oder auch chinesische Übeltäter zu ergreifen, und damit den Bemühungen dieser beiden Organisationen in den Rücken zu fallen, widerspricht dem Ziel sicherheitspolitische Annäherung diametral. Es ist kein Zufall, dass die für den negativen Entscheid leitende Bundesstelle im vom SVP-Bundesrat Guy Parmelin geführten Volkswirtschaftsdepartement angesiedelt ist.
In jüngster Zeit sind sowohl von der EU-Kommission als auch vom EU-Parlament längst bekannte Signale an die um andauernden Zugang zum Binnenmarkt kämpfende Schweiz nachdrücklich wiederholt worden. So wird es keinen Weg geben um die grundsätzliche Akzeptanz herum von Eckpfeilern der europäischen Architektur wie etwa dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Dies gilt ebenso für den von der EU angenommenen Grundsatz, dass das unter Xi Jinping zunehmend totalitäre China neben Handelspartner eben auch systemischer Rivale ist. Was bedeutet, dass gravierende Menschenrechtsverletzungen sanktioniert werden, ungeachtet und gleichlaufend mit Handelserleichterungen. In einem Moment, wo die bilateralen Beziehungen zwischen Bern und Brüssel ohnehin bis zum Zerreissen angespannt sind, erscheint das unnötige Ausscheren Berns aus der beschriebenen Sanktionsfront europapolitisch kontraproduktiv.
Das internationale Ansehen des Landes leidet
Von zentraler Bedeutung für uns ist das Ansehen der Schweiz im westlichen Ausland, beruhend auf der Überzeugung anderer, dass Helvetien demselben Wertekanon verpflichtet ist. Und nicht wie wir in Moskau, Peking, Teheran und anderen Hauptstädten gesehen werden, wo ohnehin Macht vor Recht gilt und damit auch nur Ersteres im bilateralen Verhältnis zählt. Die vage Vorstellung, die Schweiz könne als weisser Vermittlungsritter in und aus Europa im globalen Strategieumfeld eine Rolle spielen, ist illusorisch. Unser Land wird vielmehr allseits immer stärker als reiner Profiteur gesehen, der alle Vorteile des von der EU geschaffenen europäischen Umfeldes geniesst, ohne entsprechende Verpflichtungen zu übernehmen.
Wer etwas anderes behauptet, kennt unser gegenwärtiges internationales Umfeld nicht. Wie Ungarn, Polen unter nationalistischen Regierungen und allenfalls jetzt auch die Slowakei werden wir zunehmend als Bremsklotz auf dem Weg zu einer grösseren europäischen Autonomie gesehen. Ein entsprechendes Beispiel liefern kürzliche Gespräche mit offiziellen Stellen und der Zivilgesellschaft in den baltischen Staaten, die mir aus erster Hand zugekommen sind. Die zögernde und weitgehend kümmerliche Teilnahme der Schweiz an den Bemühungen zugunsten der Ukraine wurden als arttypisches Beispiel bezeichnet des nur auf Profit ausgerichteten Aussenseiters.
Noch vor 20 Jahren wurden wir in Brüssel als reicher, wenn auch bedächtiger Teilnehmer an der europäischen Einigung von Allen mit Wohlwollen gesehen. Das dürfte sich spätestens seit dem Ukrainekrieg ins Gegenteil verkehrt haben: Wir sind jetzt ein im besten Fall lästiger Beifahrer, auf den letztlich auch verzichtet werden kann. Ausser bei verhockten Nationalisten und wolkigen Idealisten dürfte allen klar sein, was das für die Schweiz bedeutet.
Voll dabei und doch isoliert in Europa von Martin Gollmer
Bei der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG), einem neuen Debattier- und Datingklub für europäische Staats- und Regierungschefs, macht die Schweiz voll mit. Doch dort, wo in Europa auch für unser Land relevante Entscheide gefällt werden, bei EU und Nato, ist die Schweiz nach wie vor nicht Mitglied.
Am 5. Oktober 2023 hat im südspanischen Granada das nun schon dritte Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs im Rahmen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) stattgefunden. Dieses Format geht auf eine Idee des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zurück, die er im Mai 2022 vor dem EU-Parlament in Strassburg vortrug. Nachdem der russische Angriff auf die Ukraine weitere Beitrittsanträge aus Osteuropa ausgelöst hatte – unter anderem von der Ukraine selbst – sagte Macron in seiner Rede: «Die Europäische Union kann aufgrund ihres hohen Grades an Integration und ihrer ehrgeizigen Ziele kurzfristig nicht das einzige Mittel sein, den europäischen Kontinent zu strukturieren.» Es sei die historische Pflicht der EU, über eine geeignete Organisation des Kontinents nachzudenken und den Beitritt nicht als einzige Antwort anzusehen.
Macron schlug deshalb die Schaffung einer «Europäischen Politischen Gemeinschaft» vor. Diese neue Organisation – eine Art Konföderation – würde es europäischen demokratischen Staaten, die das Wertefundament der EU teilen, ermöglichen einen neuen Raum der politischen Zusammenarbeit zu finden in Bereichen wie Sicherheit, Energie, Verkehr, Investitionen, Infrastruktur oder Personenverkehr. Sich dieser Gemeinschaft anzuschliessen, müsste nicht zwangsläufig zu einem EU-Beitritt führen, genauso wie sie auch jenen, die die Europäische Union verlassen haben, nicht verschlossen bliebe. Macron verstand, dass die EU angesichts der russischen Aggression in Europa ein Forum zum Austausch auf höchster politischer Ebene brauchte, dass über sie selbst hinausreichte.
Illusterer Klub mit schwierigen Mitgliedern
Zur EPG gehören zurzeit 47 Staaten – die 27 EU-Länder und die Resteuropäer von Albanien über die Schweiz bis zum Vereinigten Königreich. Nicht dabei sind Russland und Weissrussland. Lupenreine Demokratien, Friedensförderer und Rechtsstaatverfechter sind auch so nicht alle. In der EU bereiten diesbezüglich Polen und Ungarn Sorgen. Mitglied in der EPG ist zudem Aserbaidschan, das eben in einem Krieg gegen Armenien (ebenfalls Mitglied) die Region Berg Karabach annektiert hat. Auch Serbien ist dabei, das im Konflikt mit Kosovo (ebenfalls Mitglied) derzeit wieder für negative Schlagzeilen sorgt. Schliesslich gehört auch die Türkei zum Klub trotz ihres autokratischen Regimes von Präsident Recep Tayyip Erdogan.
Die Treffen der Staats- und Regierungschefs der EPG finden halbjährlich statt – einmal in einem EU-Land, einmal ausserhalb der EU. Die Zusammenkünfte haben informellen Charakter; gemeinsame Beschlüsse oder eine Abschlusserklärung gibt es keine. Auf der Agenda stehen jeweils Diskussionen zu aktuellen Themen – in Granada gab es drei Arbeitsgruppen zu den Bereichen Digitalisierung, Energie/grüner Umbau und Multilateralismus/Geostrategie. Daneben kommt es zu zahlreichen bilateralen Treffen zwischen Staats- und Regierungschefs. So traf etwa Bundespräsident Alain Berset, der die Schweiz in Granada zusammen mit Staatssekretär Alexandre Fasel vertrat, Frankreichs Präsidenten Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die Ministerpräsidenten von Luxemburg, den Niederlanden, Irlands und Albaniens sowie die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Berset bezeichnete denn auch die EPG als sehr nützliches Format.
Abwesend, dort wo es wirklich zählt
In der EPG ist die Schweiz also voll dabei. Das ist gut so. Vor allem die Möglichkeit, im Rahmen der EPG Kontakte zu anderen europäischen Ländern – und insbesondere zu EU-Staaten – knüpfen zu können, ist für die Schweiz in ihrer selbstgewählten teilweisen Isolation in Europa wertvoll. Trotzdem bleibt die EPG vorerst ein Debattier- und Datingklub für europäische Staats- und Regierungschefs. Dies, auch wenn manche Beobachter die EPG schon als einen der Kreise ansehen, die eine EU mit verschiedenen Integrationsgraden zukünftig um sich herum ziehen könnte. Die EPG kann eine Mitgliedschaft der Schweiz in der EU – der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Organisation Europas – denn auch einstweilen nicht ersetzen. Auch ein Ersatz für eine Mitgliedschaft in der Nato, dem nordatlantischen Verteidigungsbündnis, ist die EPG nicht. Die Nato ist die wichtigste sicherheits- und verteidigungspolitische Organisation Europas.
Staats- und Regierungschefs, Minister, Diplomaten, Regierungsbeamte und Parlamentarier aus den Mitgliedstaaten dieser beiden Staatenbündnisse treffen sich in hohem Rhythmus, diskutieren Themen der Aktualität und fassen Beschlüsse dazu. Von diesem regelmässigen Austausch sind Vertreter der Schweiz ausgeschlossen. Sie können – sieht man von ein paar wenigen Ausnahmen ab – nicht mitreden, wenn in den Gremien von EU und Nato Entscheidungen vorbereitet werden. Und sie können überhaupt nirgends mitentscheiden. Mit andern Worten: Die Schweiz ist in den beiden wichtigsten Organisationen Europas als Nicht-Mitglied weitgehend isoliert und ohne Stimme.
Eigentlich ein unhaltbarer Zustand
Das ist umso problematischer, als das, was EU und Nato tun, weit über das Gebiet ihrer Mitgliedstaaten hinaus Wirkung hat. Auch die Schweiz ist betroffen. So übernimmt sie seit über 30 Jahren regelmässig und bewusst EU-Recht, um Nachteile ihrer Einwohner und Unternehmen im Verkehr mit der Europäischen Union zu vermeiden. Dieser Nachvollzug hat beachtliche Ausmasse erreicht. Wissenschaftlichen Studien zufolge sollen zwischen 40 und 60 Prozent des schweizerischen Rechts direkt oder indirekt von EU-Recht beeinflusst sein. Damit hat die Schweiz gemäss dem an der Universität Zürich lehrenden Europarechtlers Matthias Oesch durchaus wichtige Teile ihrer Rechtssetzung faktisch an die EU delegiert. Das ist ein unhaltbarer Zustand für ein Land, das grossen Wert auf seine Souveränität legt.
Auch von den Tätigkeiten der Nato ist die Schweiz betroffen. Was diese in Sachen Verteidigung tut oder lässt, beeinflusst auch die Sicherheit der Eidgenossenschaft. Mitten in Nato-Gebiet gelegen, profitiert die Schweiz vom Schutzschirm, den das Militärbündnis über Europa aufgespannt hat. Das ist wichtig, denn das Land könnte sich im Fall eines militärischen Angriffs kaum lange selbst verteidigen.
Doch statt in der EU und in der Nato voll mitzumachen und die Zukunft Europas mitzugestalten und mitzuentscheiden, begnügt sich die Schweiz mit Kooperationen und bilateralen Verträgen. Immerhin will sie diese ausbauen. Doch auch das ist immer noch zu wenig für ein Land, das mitten in Europa liegt und mit diesem kulturell, wertemässig und wirtschaftlich aufs Engste verbunden ist.