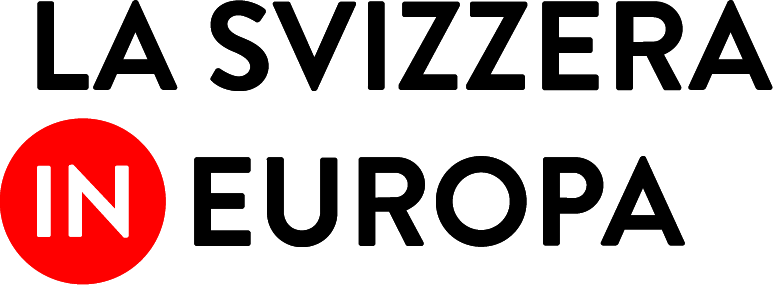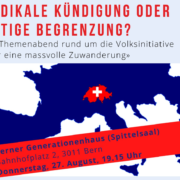Je constate avec perplexité que la campagne « Pour une immigration modérée » fait abstraction de la détérioration des relations internationales. Or, cette détérioration interpelle notre pays en raison de la modification des positionnements respectifs de nos principaux partenaires : les Etats-Unis, la Chine et l’UE, qui représentent 45% du commerce mondial. Voyons le problème.
Les Etats-Unis
Depuis son accession à la Présidence, Trump s’emploie à démanteler l’ordre multilatéral d’après-guerre accusant ses membres d’en détourner les règles. Il s’ensuit que les Etats-Unis se servent maintenant du multilatéralisme comme d’un menu à la carte. Ils le défendent s’ils y ont intérêt et, l’entravent dans le cas contraire. Cette pratique est particulièrement déstabilisante pour un pays de notre taille car elle foule aux pieds les principes de l’ordre juridique multilatéral qui a notamment eu pour mérite de réfréner les velléités unilatérales des grandes puissances. Ce délitement a pour conséquence que les Etats-Unis prennent des libertés à propos de traités et d’alliances qu’ils ont conclus, voire utilisent l’arme du dollar pour imposer des sanctions. La Suisse par exemple figure sur une liste grise du Trésor américain et risque d’être sanctionnée à tout moment au motif que la BNS, en « manipulant » le cours du franc génère des excédents commerciaux et courants excessifs envers les Etats-Unis. Il en découle que la Suisse ne peut plus compter, comme autrefois, sur la fiabilité des Etats-Unis et, étant désormais davantage isolée institutionnellement, elle doit agir avec encore plus de doigté.
La Chine
En 2001 le monde pensait que la Chine, en adhérant à l’OMC et à ses règles de libre échange, évoluerait vers un régime démocratique. Or, avec l’accession de Xi Jin Ping au pouvoir en 2012, c’est l’inverse qui s’est produit. Xi entend reconquérir la prééminence historique de la Chine que le colonialisme lui a ravi. Pour y parvenir il a durci le pouvoir politique, renforcé l’autorité du Parti communiste et discrédite maintenant les valeurs libérales du système de gouvernance occidental en prônant la supériorité du régime socialiste chinois. Au plan international, la Chine tire avantage du repli multilatéral des Etats-Unis pour se donner les allures d’une puissance responsable et respectueuse de l’ordre international dont elle ne manque pas de se servir habilement pour accroître son influence, imposer progressivement ses valeurs et ses programmes : Nouvelles Routes de la Soie par exemple. En outre, la Chine s’emploie avec force moyens à se rendre autarcique dans les technologies de pointe. A cette fin, elle n’hésite pas à piller les brevets, voire à se livrer à des cyberattaques dans des domaines sensibles : santé, énergie, télécommunications etc.
Face à la Chine, la Suisse doit être particulièrement prudente pour les raisons suivantes :
- L’ordre multilatéral que prône la Chine diffère de l’ordre libéral d’après-guerre dans quatre domaines clé au moins :
-capitalisme étatique
-non-ingérence dans la affaires nationales
-propriété intellectuelle
-droits de l’homme
- Le régime autoritaire chinois actuel peut à tout moment faire volte- face. Il est donc moins fiable, plus aléatoire. Etant donné le recul de l’ordre multilatéral libéral la Suisse, qui n’est pas intégrée dans un grand bloc, a perdu une partie de son pouvoir de négociation. Elle est donc plus vulnérable et doit agir avec d’autant plus de circonspection.
- Mais, par rapport à ces incertitudes, la Suisse doit également prendre en compte :
-l’importance du marché chinois ( 1,4 milliard d’habitants) et son développement fulgurant
-le poids de ce marché dans nos échanges commerciaux – la Chine est déjà notre troisième partenaire derrière l’UE et les Etats-Unis.
-l’importance croissante des investissements dans les deux sens
-notre dépendance des chaînes de valeur localisées en Chine.
L’Union Européenne
L’UE reste fidèle au multilatéralisme libéral d’après-guerre et s’efforce de la promouvoir en concluant de nombreux accords de libre-échange reposant sur les principes de cet ordre. Mais l’UE est limitée dans ses efforts car elle doit en même temps lutter pour maintenir sa cohésion interne et affronter les tentatives de déstabilisation venant des Etats-Unis, de la Chine, de la Russie et même de la Turquie. Industriellement, l’UE est une grande puissance, mais surtout dans les secteurs traditionnels et moins dans les technologies de pointe. Consciente de cette faiblesse elle s’efforce de la corriger. A propos de la confrontation sino-américaine, l’UE devra procéder à des arbitrages délicats pour constituer une entité unie et solide. Ainsi, même si elle partage une partie des griefs des Etats-Unis contre la Chine, elle n’est pas en accord avec eux, notamment à l’OMC.
En outre, envers la Chine, l’UE ne forme pas un bloc monolithique car ses pays membres ont des divergences d’intérêts. Il n’en demeure pas moins, malgré les faiblesses dues à l’incomplétude de sa construction, que l’UE, pour rester une grande puissance sur la scène internationale, devra se positionner face à la confrontation sino-américaine. Elle en a les moyens, pour autant que le nouvel engagement politique de ses dirigeants reste à la hauteur des enjeux que représentent la préservation de son indépendance.
Je tiens cette indépendance pour cruciale en raison de l’intensification et de l’élargissement des champs de confrontation sino-américains. En effet, alors qu’initialement cette confrontation était bilatérale et commerciale, elle s’est ensuite étendue aux pratiques chinoises déloyales générées par le capitalisme étatique et l’inégalité d’accès au marché chinois. Cette confrontation s’est ensuite mondialisée au fur et à mesure qu’elle englobait de nouveaux domaines : la sécurité, la technologie et la santé. Bref, au point où en sont actuellement les choses, cette confrontation est désormais structurelle et irréversible, idéologique et hégémonique. C’est pourquoi, par rapports à ces défis cruciaux, il faut espérer que l’UE parvienne à uniformiser les vues de ses membres pour préserver son indépendance et éviter de tomber sous la coupe des Etats-Unis ou de la Chine. J’ajouterais que, aux risques que je viens de mentionner, s’en profile un nouveau, celui d’un découplage du monde qui pourrait forcer les Etats à devoir choisir le camp avec lequel ils entendent collaborer. Face à ce nouveau risque il faut aussi que l’UE parle d’une seule voix car, à défaut, elle se décomposerait et ses membres seraient vassalisés.
*
Au terme de ce parcours géopolitique, toile de fond de l’initiative « Pour une immigration modérée », il m’apparaît évident que la Suisse, dans la nouvelle constellation mondiale qui se dessine, est moins à même de faire cavalier seul pour défendre ses intérêts, d’autant plus qu’elle est désormais davantage isolée institutionnellement en raison de l’affaiblissement du multilatéralisme d’après-guerre, qui fut un des piliers de sa prospérité. Il nous faut donc choisir entre les Etats-Unis, la Chine et l’UE le partenaire avec lequel nous voulons collaborer le plus étroitement. A mon sens, il ne fait pas de doute que c’est l’UE que nous devons. En effet, comme je l’ai démontré, il y a des limites à une collaboration fructueuse tant avec les Etats-Unis qu’avec la Chine.
L’UE, malgré ses faiblesses, est et restera dans un avenir prévisible notre partenaire le plus important et le plus fiable, ne serait-ce qu’à cause des multiples affinités socio-culturelles qui nous lient. En votant le 27 septembre 2020, n’oublions pas le désastre économique qu’avait provoqué en 1992 notre refus de l’EEE. Ce vote nous en effet valu dix ans de marasme économique jusqu’à ce que l’UE consente en 1999 à nous ouvrir la voie bilatérale. Grâce à cet heureux dénouement, notre économie a rebondi et de nombreux accords ont été conclus dans l’intérêt des deux parties. Sans vouloir minimiser les enjeux du vote du 27 septembre – bien qu’à mon sens ils soient solubles – ils sont les arbres qui cachent la forêt des défis autrement plus dangereux que j’ai évoqués et pour lesquels nous avons besoin de pouvoir naviguer de concert avec l’UE.
J’espère donc que nous saurons voter dans l’intérêt à long terme de notre pays.
Jean Zwahlen
Ancien Ambassadeur et Directeur Général de la BNS
Membre du Comité de l’ASE