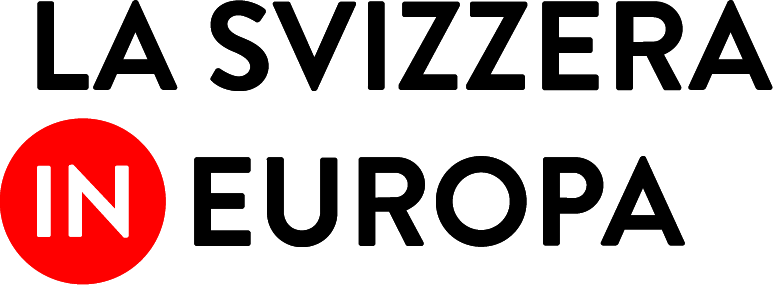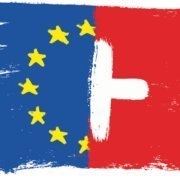Die schweizerische Aussenpolitik weist Löcher auf: Auf globaler Ebene macht die Schweiz in allen wichtigen internationalen Organisationen mit. Auf europäischer Ebene ist das anders. Hier ist die Schweiz weder bei der EU noch bei der Nato Mitglied. Das erstaunt und sollte geändert werden.
Im vergangenen Mai hatte die Schweiz die monatlich wechselnde Präsidentschaft im Uno-Sicherheitsrat inne. In diesem Gremium sitzt sie als einer der zehn nichtständigen Mitgliedstaaten seit Anfang 2023 – und noch bis Ende 2024. Der Sicherheitsrat ist auf globaler Ebene das wichtigste Uno-Organ im Bereich der Friedensförderung und internationalen Sicherheit. Der Präsidentschaft obliegt die Leitung der Sitzungen des Sicherheitsrats. Dabei kann sie auch ihre eigenen Prioritäten in den Fokus der Ratsarbeit stellen. Die Schweiz tat dies etwa mit den Themen «nachhaltigen Frieden fördern» und «Zivilbevölkerung in Konflikten schützen».
Die Schweiz brachte ihre Präsidentschaft im Uno-Sicherheitsrat – und ihre Einsitznahme in diesem Gremium – bisher ohne Probleme über die Runden. Die schweizerische Diplomatie war immer rechtzeitig – auch dank zusätzlichem Personal – mit Stellungnahmen zu den im Rat debattierten Themen bereit. Die Neutralität war dazu kein Hindernis. Die Schweiz verurteilte den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine als flagrante Völkerrechtsverletzung aufs Schärfste und konnte in andern Konflikten vermittelnd wirken. Gleichwohl gelang es auch der Schweiz nicht, die immer wieder auftretenden, auf das Vetorecht der fünf ständigen Mitgliedstaaten China, Frankreich, Grossbritannien, Russland und USA zurückzuführenden Blockaden im Sicherheitsrat zu überwinden. Trotzdem lässt sich feststellen: Die Schweiz ist in der Lage, auf höchster internationaler Ebene ihre Interessen einzubringen und erfolgreich mitzumischen.
Die Uno wurde 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Allianz der Siegermächte gegründet. Heute gehören ihr 193 Staaten an. Sie ist universell geworden. Ihre wichtigsten Aufgaben sind gemäss ihrer Charta die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Ausserdem ist die Uno auf wirtschaftlichen, sozialen, humanitären und ökologischen Gebieten tätig. Mehrere Uno-Organisationen haben ihren Sitz in der Schweiz, vor allem in Genf. Sie liessen sich dort in Nachfolge des Völkerbunds nieder lange bevor die Schweiz Mitglied wurde.
Der Beitritt der Schweiz zur UNO war mühsam und wurde lange von nationalkonservativen Kräften als mit der Neutralität und der Unabhängigkeit des Landes nicht vereinbar bekämpft. Die Mitgliedschaft beschränkte sich vorerst auf Sonderorganisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie dem Internationalen Gerichtshof in den Haag. Die Schweiz trat den Vereinten Nationen – wie die Organisation auch genannt wird – als Vollmitglied erst 2002 auf Grund einer Volksinitiative bei. Damals stimmten 55 Prozent der Bevölkerung und eine nur knappe Mehrheit der Kantone dem Beitritt zu. Zuvor scheiterte 1986 ein erster Anlauf in einer Volksabstimmung noch mit 76 Prozent Nein-Stimmen. Die öffentliche Meinung wandelte sich innerhalb von 15 Jahren grundlegend.
Mitmachen verursacht weder Aufsehen noch Probleme
Ausser in der Uno ist die Schweiz auch in allen anderen wichtigen und global ausgerichteten internationalen Organisationen vertreten. Seit 1992 ist sie Mitglied des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, nachdem der Beitritt zu den beiden Bretton-Woods-Institutionen in einer Volksabstimmung mit 56 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen wurde. Auch hier erfolgte der Beitritt der Schweiz verspätet: IWF und Weltbank wurden im Gefolge der Unterzeichnung des Abkommens von Bretton Woods im Jahr 1944 gegründet. Der IWF stellt Ländern, die – oft aufgrund von Zahlungsbilanzschwierigkeiten – Bedarf an Fremdwährung haben, Brückenfinanzierung bereit, verbunden mit Spar- und Stabilisierungsmassnahmen für das unterstützte Land. Die Weltbank vergibt Kredite für langfristige Entwicklungs- und Aufbauprojekte in der Realwirtschaft vor allem von ärmeren Staaten. Dem IWF gehören 190 Länder an, der Weltbank 189.
Die Schweiz trat dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen GATT 1966 bei. Seit 1995 ist sie bei der Welthandelsorganisation (WTO) dabei. Sie wurde 1994 aus dem GATT in der sogenannten Uruguay-Runde nach siebenjähriger Verhandlungszeit gegründet und hat ihren Sitz in Genf. Ihre Aufgabe ist die Regelung und Vereinfachung grenzüberschreitender Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie die damit verbundene Streitschlichtung zwischen Ländern. Heute gehören der WTO 164 Staaten an, die 98 Prozent des Welthandels bestreiten. Die Schweiz ist seit der Gründung der WTO deren Mitglied. Sie unterliegt hier auch der Schiedsgerichtsbarkeit und stellte immer wieder Schiedsrichter in internationalen Streitfällen.
Schliesslich ist die Schweiz Gründungsmitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Diese erarbeitet Grundlagen der Wirtschaftspolitik und internationale Normen sowie evidenzgestützte Lösungen für ein breites Spektrum sozialer, ökonomischer und ökologischer Herausforderungen. Zurzeit ist sie wegen ihrem Projekt für eine globale Mindeststeuer für Unternehmen in aller Leute Munde. Die OECD ging 1961 aus der 1948 gegründeten Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) hervor. Diese sollte damals den Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Europas koordinieren. Der OECD gehören heute 38 vor allem entwickelte Länder auf der ganzen Welt an.
In allen diesen global aktiven internationalen Organisationen arbeitet die Schweiz heute mit, ohne dass das grösseres Aufsehen erregt oder grössere Probleme hervorruft. Wesensmerkmale wie die direkte Demokratie, der föderalistische Staatsaufbau, die sozial abgefederte Marktwirtschaft oder die bewaffnete Neutralität konnten unbeschadet beibehalten werden. Hier sitzt die Schweiz mit am Tisch und vertritt selbstbewusst ihre Interessen. Ängste vor fremden Richtern bestehen hier nicht.
Lieber nachvollziehen statt mitentscheiden
Anders sieht es in Europa aus. Hier ist die Schweiz neben fachlichen Organisationen nur im Europarat und in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vertreten. Der 1949 gegründete Europarat setzt sich für die Einhaltung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein. 46 europäische Länder gehören ihm heute an. Die Schweiz trat erst im Jahr 1963 bei, nach langen und heftigen Debatten zur Neutralität des Landes. Erst 1974 trat sie der Europäischen Menschenrechtkonvention (EMRK) bei nachdem das Hindernis des fehlenden Frauenstimmrechts aus dem Wege geräumt war.
Die Ziele der OSZE sind die Sicherung des Friedens in Europa und der Wiederaufbau nach Konflikten. 57 Staaten aus Europa, Nordamerika (USA und Kanada) und Asien (Mongolei) sind heute Mitglied der OSZE. Sie ging 1995 aus der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) hervor. Diese wurde 1975 mit der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki ins Leben gerufen. Für den Ostblock brachte die KSZE die Anerkennung der Grenzen der Nachkriegsordnung und einen stärkeren wirtschaftlichen Austausch mit dem Westen. Im Gegenzug machte der Osten Zugeständnisse bei den Menschenrechten. Die Schweiz war bei KSZE und OSZE seit deren Anfängen mit dabei.
In der Europäischen Union (EU) und in der Nordatlantischen Vertragsorganisation (Nato) ist die Schweiz dagegen nicht vertreten. Zwar reichte die Schweiz 1992 bei der EU ein Beitrittsgesuch ein. Dieses wurde aber nach dem knappen Nein des Stimmvolks zum Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) im selben Jahr auf Eis gelegt. 2001 lehnten die Schweizerinnen und Schweizer mit 77 Prozent Nein-Stimmen die sofortige Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU ab. 2016 wurde das Beitrittsgesuch schliesslich zurückgezogen. Weil die Neutralität der Schweiz scheinbar unverzichtbar ist, stand ein Beitritt zur Nato nie zur Diskussion.
Das Abseitsstehen der Schweiz bei EU und Nato erstaunt: Die EU ist mit zurzeit 27 Mitgliedstaaten die wichtigste wirtschaftliche und politische Organisation Europas, die Nato mit gegenwärtig 31 Mitgliedsländern (darunter den USA) die wichtigste sicherheits- und verteidigungspolitische. Die Vorläuferorganisationen der EU gehen auf das Jahr 1951 zurück, die Nato wurde 1949 zur Eindämmung der damaligen Sowjetunion gegründet. Mit der EU ist die Schweiz aufs Engste verflochten – geografisch, wirtschaftlich, rechtlich, kulturell, personell. Und die Sicherheit der Schweiz in Europa ist ganz wesentlich dem militärischen Schutzschirm der Nato zu verdanken. Mit beiden Organisationen kooperiert die Schweiz deshalb. Ein Ausbau der Zusammenarbeit – und nicht mehr – wird zurzeit angestrebt.
So sitzt denn die Schweiz nicht mit am Tisch, wenn EU und Nato Beschlüsse fassen, die auch das Land betreffen. Allein im Bereich der EU-Abkommen von Schengen und Dublin geniesst sie Mitsprache. Sie kann nicht mitentscheiden, muss aber oft nachvollziehen. Das ist aus souveränitäts- und demokratiepolitischer Sicht höchst problematisch. Es ist deshalb an der Zeit, dass eine sachliche Debatte ohne Vorbehalte über die schweizerische Mitgliedschaft in EU und Nato beginnt – damit die Schweiz in Zukunft hoffentlich auch bei diesen beiden Organisationen mit dabei sein kann.
Die Erfahrung auf globaler Ebene zeigt, dass sich die Schweiz erfolgreich in internationale Organisationen einbringt und sich Ängste vor Souveränitätsverlusten und aus Gründen der Neutralität als unbegründet erwiesen haben. Niemand stellt heute die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen mehr in Frage. Die gleiche Entwicklung ist auch auf europäischer Ebene möglich und nötig. Nur wenn die Schweiz hier überall mitmacht, kann sie ihre Interessen umfassend wahren und sich im Lichte neuer geopolitischer Herausforderungen auch auf europäischer Ebene weiterentwickeln.