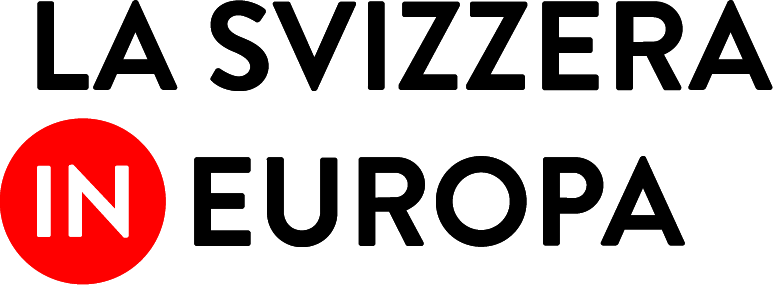Kündigung der Menschenrechtskonvention: Das wären die Folgen von Markus Mohler
Weil ihnen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht passt, wollen Teile der SVP die Europäische Menschenrechtskonvention kündigen. Das würde die Mitgliedschaft der Schweiz im Europarat sowie zahlreiche von ihr unterzeichnete Europarats-Konventionen gefährden.
Schon mehrfach, nun aber im Nachgang zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg über die Beschwerde der Klimaseniorinnen vernehmbar lauter, ist die Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) von Parlamentsmitgliedern der SVP erwogen worden. Das plakative Stichwort dazu lautet «keine fremden Richter!».
Offenbar gibt man sich zunächst keinerlei Rechenschaft darüber, welche Konsequenzen dies hätte. Eine Kündigung der EMRK ist gemäss Art. 58 der EMRK möglich. Sie hätte aber wohl den Ausschluss aus dem Europarat oder doch die Suspendierung der Mitgliederrechte zur Folge (Art. 3 der Statuten des Europarates). Solche Erwägungen sind besonders pikant im Moment, in dem sich die Schweiz mit Alt-Bundesrat Alain Berset um den Posten des Generalsekretärs des Europarates bemüht hat. Berset wurde schliesslich trotzdem gewählt.
Was an der Europarats-Mitgliedschaft hängt
Eine Reihe von Konventionen des Europarates zur Erleichterung der internationalen Zusammenarbeit in verschiedenen Rechtsgebeten sind direkt an die Europarats-Mitgliedschaft gebunden, so z.B. das Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus (SR 0.353.3, Art. 11 Ziff. 1), das Europäische Übereinkommen über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (SR 0.312.5, Art. 14) oder das Europäische Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts (SR 0.211.230.01, Art. 21) u.a.m.
Weitere Konventionen des Europarates stehen zwar auch Nicht-Mitgliedern des Europarates zur Unterzeichnung offen, jedoch ist die Annahme seitens des Europarates an Bedingungen gebunden. Dabei sind zwei verschiedene Arten zu unterscheiden. Eine mitunter politisch sehr hohe Hürde ist jene, dass die Genehmigung des Beitritts zu einer Konvention eines Nicht-Mitgliedstaates von der Einstimmigkeit aller Europaratsmitglieder, die das jeweilige Abkommen ratifiziert haben, abhängt, so z.B. das Europäische Auslieferungsübereinkommen (SR 0.353.1, Art. 30 Ziff. 1), das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (SR 0.351.1, Art. 28 Ziff. 1), das Übereinkommen des Europarats über einen ganzheitlichen Ansatz für Sicherheit, Schutz und Dienstleistungen bei Fußballspielen und anderen Sportveranstaltungen SR 0.415.31, Art. 18 Abs. 1), das Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (SR 0.311.53, Art. 37 Ziff. 1). Anderen Übereinkommen können Nicht-Mitgliedstaaten des Europarates beitreten, sofern sie an deren Ausarbeitung beteiligt waren.
Die Reputation der Schweiz nähme Schaden
Besonders ins Gewicht fällt neben diesen schwerwiegenden vertragsrechtlichen Nachteilen, dass die Reputation der Schweiz als Rechtsstaat und als Hort des Grundrechtschutzes massiv leidet und bei jeder sich bietenden Gelegenheit in Zweifel gezogen werden kann.
Nicht zu übersehen ist, dass die Argumentation mit den fremden Richtern insofern vorgeschoben ist, als die SVP sich dadurch ausgezeichnet hat, Bundesrichter, die nicht entlang einer Parteidoktrin zu entscheiden wagen, mit der Nichtwiederwahl zu drohen (Fall Bundesrichter Donallaz). Das war ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Gerichte, auf die Gewaltenteilung. Deutlich wurde diese Unredlichkeit mit dem Bundesgerichtsurteil 145 IV 114 (6B_1314/2016/6B_1318/2016) vom 10. Oktober 2018. Das Bundesgericht hatte zu entscheiden, ob auf den Cayman Islands das schweizerische Bankengesetz anwendbar und gerichtlich von hier aus durchsetzbar sei. Mit mit 3:2 Stimmen hat es entschieden, dass das schweizerische Bankengesetz auf den Cayman Islands, zumal für eine Nichtbank, nicht gelte und somit auch keine Verletzung des Bankkundengeheimnisses vorliege. Die beiden abweichenden Richterstimmen stammten von der Richterin und dem Richter, die der SVP angehören. Sie also traten dafür ein, das auf den Cayman Islands schweizerisches, also fremdes Recht und ebenso fremde, schweizerische Richter massgebend und zuständig sein sollten.
Keine Tricksereien mit der EMRK!
Die EMRK darf nicht für politische Tricksereien missbraucht werden. Ihre Bedeutung ist für die Prinzipien der Rechtstaatlichkeit und der Demokratie, der Freiheit von fundamentaler Bedeutung, der Kern dessen, was als Wertegemeinschaft gegenüber autoritären militärischen und politischen Angriffen geltend gemacht wird. In Erinnerung zu rufen, ist auch das Votum der SVP-Fraktionssprecherin anlässlich der Debatte über die Genehmigung der EMRK am 2. Oktober 1974: «Die Fraktion ist der Auffassung, dass die Menschenrechtskonvention, die aus der Konfrontation der westlichen Demokratien mit dem kommunistischen System entstanden ist, ein wirksameres Mittel darstellt, um dem Gedanken an ein geeintes Europa zu dienen. Als unser Land dem Europarat beitrat, bekundeten wir damit unsere Verbundenheit mit den Werten, die das gemeinsame Erbe der Völker Europas sind» (AB 1974 N 1476 f.).
Ein Urteil des EGMR, das auch mit juristischen Argumenten kritisiert wurde, ist kein Grund deswegen die EMRK abzulehnen. Es käme niemandem in den Sinn, nach einem missliebigen Urteil eines schweizerischen Gerichts, die Gesetzesgrundlagen, auf die sich das Gericht stützte, abzulehnen, selbst wenn deren gerichtliche Interpretation nicht zu überzeugen vermochte.