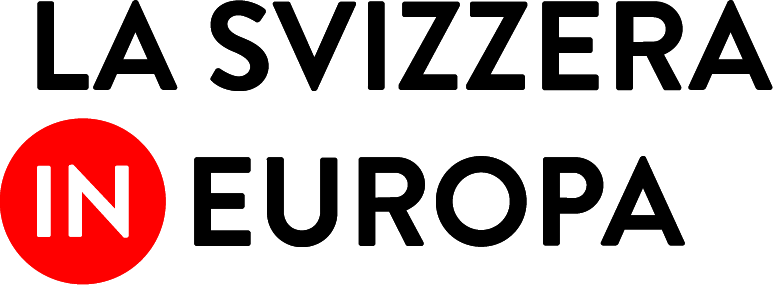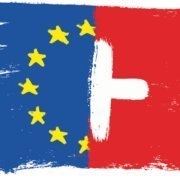Die Bilateralen III dienen der Sicherung des Zugangs der Exportindustrie und ihrer Zulieferer zum EU-Binnenmarkt und der Versorgungssicherheit der Schweiz. Das Vertragswerk, das noch fertig ausgehandelt werden muss, ermöglicht die Aufdatierung erodierender Abkommen der Bilateralen I und II. Es stellt die volle Teilnahme an Kooperationsprogrammen der EU sicher, namentlich in Bildung und Forschung. Es sieht den Abschluss weiterer Abkommen in den Bereichen Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit vor. Was den institutionellen Teil der Bilateralen III betrifft, bleiben die Rechte von Parlament und Volk trotz dynamischer Übernahme von EU-Erlassen gewahrt. Die Schweiz erhält eine Mitsprache bei der Vorbereitung von EU-Recht, dass sie übernehmen muss. Bei der Streitschlichtung wird der Europäische Gerichtshof beigezogen, wenn es um die Auslegung unklaren oder strittigen EU-Rechts geht. Das letzte Urteil fällt aber im Streitfall ein paritätisch besetztes Schiedsgericht. Insgesamt sind die Bilateralen III ein faires Bündnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union.
I. Eine Frage der Aufgabenverteilung
Die Aufgabenverteilung unter den verschiedenen Stufen des Gemeinwesens – von der Gemeinde, zum Kanton, über den Bund auf die europäische und die globale Ebene – gehört zu den Kernaufgaben föderaler Politik. Sie ist stets umstritten zwischen konservativen Kräften, die an der alten Ordnung festhalten, und jenen, die neue Herausforderungen offen angehen und Chancen wahrnehmen wollen. Veränderungen der Aufgabenverteilung sind meist durch technologische Fortschritte und die damit verbundenen Erweiterungen der Märkte bedingt, von der Dampfmaschine bis zur künstlicher Intelligenz. Die Rechtsordnung muss darin ihren Weg finden und sich neu ausrichten. Grundlegende Änderungen erfolgten meist revolutionär, wie mit der Bundesverfassung von 1848. Nach dem 2. Weltkrieg gelang es in Europa und weltweit, den Wandel schrittweise zu vollziehen und das Völkerrecht der Zusammenarbeit zu stärken und die europäische Integration in Etappen zu entwickeln.
Heute muss Vieles transnational geregelt werden. Es ist offensichtlich, dass das Internet nicht auf Ebene der Gemeinde geregelt werden kann. Und wer von Kloten oder Cointrin in die weite Welt fliegt, kann dies tun, weil das Recht der zivilen Luftfahrt in Europa und der Schweiz voll harmonisiert ist und weltweit völkerrechtlichen Regeln (darunter ICAO) und technischen Normen untersteht. Wer weltweit exportiert stützt sich auf Regeln, die an die Welthandelsorganisation (WTO) delegiert wurden, und verlässt sich auf deren Umsetzung. Er hält sich an international ausgehandelte Produktionsstandards. Diese begrenzen den Handlungsspielraum der Staaten, so auch der Schweiz. Gleichzeitig erweitern diese eng ineinander verzahnten Regelungssphären auch die Handlungsspielräume privater Akteure und der Nationalstaaten, die ihre Interessen in internationalen Foren einbringen können.
Das Recht ist heute in hohem Masse international vernetzt. Diese Regeln wirken oftmals im Hintergrund, gewissermassen als Teil des Betriebssystems. Es gibt heute mehr Staatsverträge als Gesetze und Verordnungen in der systematischen Rechtssammlung des Bundes. Sie sind in der Alltagspolitik nicht präsent und wenig bekannt. Dieses Unwissen erlaubt es, die Bilateralen III als etwa Ausserordentliches, ja als Staatsgefährdung zu stilisieren und so die Stimmbürgerschaft gegen Europa zu mobilisieren, Verlustängste zu bewirtschaften und damit strukturerhaltend protektionistische Interessen der Binnenwirtschaft, der Landwirtschaft und der Finanzindustrie zu bedienen.
II. Notwendigkeit des Abkommens
Die Zuordnung wirtschaftsrechtlicher Kompetenzen in den Bilateralen III dient der Sicherung der Marktteilnahme der Exportindustrie und ihrer Zulieferer am europäischen Wirtschaftsraum und der Versorgungssicherheit des Landes. Beides ist vordringlich, angesichts der Hochpreisinsel, der Frankenstärke und der geopolitischen Veränderungen. Stimmen aus der Industrie legen dies überzeugend dar (NZZ vom 19.1.24). Das Vertragswerk ermöglicht die Aufdatierung erodierender Abkommen der Bilateralen I und II. Es stellt die volle Teilnahme an Kooperationsprogrammen sicher, namentlich in Bildung und Forschung. Die Zeit drängt. Die UBS rechnet in der Industrie mit einem Verlust von 5000 Stellen in der kommenden Zeit (Tagesanzeiger vom 30.1.24). Es geht dabei nicht nur um die Interessen einzelner Unternehmungen, sondern darum, ob weiterhin in der Schweiz als Wirtschaftsstandort investiert und produziert wird, ob Steuern hier in Gemeinden, Kantonen und Bund anfallen, um Infrastruktur, Bildung, Sozialwerke, Landwirtschaft und Landesverteidigung zu finanzieren. Es geht darum, ob im Winter genügend Strom in der Energiewende und die Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln sichergestellt werden kann. Dazu braucht der Handel vertraglich gesicherte, diskriminierungsfreie Rahmenbedingungen. Es geht schliesslich politisch darum, der Anschuldigung des Trittbrettfahrens zu begegnen. Die Kantonsregierungen unterstützen vor diesem Hintergrund das Verhandlungsmandat des Bundesrates und einen raschen Abschluss der Verhandlungen. (NZZ vom 2.2.24).
Die Teilnahme am europäischen Arbeitsmarkt bleibt zentral und bildet die Grundlage des gesamten Vertragswerkes. Die Forderung einer Kontingentierung der europäischen Arbeitskräfte (Interview NZZ vom 27.1.24) führt nicht nur zu einem korruptionsanfälligen administrativen Aufwand und Verteilungskampf zwischen Kantonen und Zentren, sondern erinnert auch an Zeiten im 19. Jahrhundert als Schwyz sich vor der Einwanderung aus Zürich fürchtete. Die Schweiz hatte während Jahrzehnten ein System der kontingentierten Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Es führte zu einer grossen Bürokratie, sozialen Missständen, Kosten für die Unternehmen und bewirkte keine Senkung der Zuwanderung – im Gegenteil. Und die heutige Debatte um den Lohnschutz lässt verkennen, dass die Gewerkschaften damit in erster Linie die Ausweitung der Gesamtarbeitsverträge bezwecken und damit ein innenpolitisches Problem bewirtschaften. Der im EU-Recht heute anerkannte Grundsatz «gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort» vermag das Lohnniveau hinreichend zu schützen, auch gegen eine diesem Grundsatz gegenwärtig noch widersprechende Spesenordnung.
III. Freihandelsverträge genügen nicht
Anstelle der Bilateralen III wird erstens ein erweitertes Freihandelsankommen mit der EU nach dem Vorbild der Abkommen der EU mit Kanada oder mit Grossbritannien verlangt. Diese Abkommen sind im Vergleich mit dem Freihandelsabkommen der Schweiz und der EU von 1972 umfassender. Sie regeln Waren, Dienstleistungen und Investitionen, die Nachhaltigkeit, teilweise auch die Energie. Sie verzichten auf die Übernahme von EU-Recht. Sie umfassen aber auch keine gegenseitige Anerkennung von Vorschriften, was den Handel trotz Nullzöllen im nichttarifären Bereich erheblich erschwert. Sie schliessen sodann eine Mitsprache bei der Ausarbeitung inländischer Vorschriften aus. Sie beschränken sich mit andern Worten auf Markzugang. Sie umfassen keine Markteilnahme.
Diese Unterscheidung ist zentral für den Schweizer Wirtschaftsstandort. Der Marktzugang ermöglicht den Grenzübertritt für Güter und Dienstleistungen. Diese unterliegen aber dann andern Regulierungen, so namentlich bei der Zulassung, technischen Normen, Haftungsrecht, Marktüberwachung. Bei der Marktteilnahme gibt es diese Grenze in technischer und regulatorischer Hinsicht nicht mehr. Es gibt einen Markt mit den gleichen Spielregeln für alle Teilnehmer am Binnenmarkt. Für Produzenten und Käufer gelten dann in einem Markt mit rund 500 Millionen Konsumierenden die gleichen Marktregeln. Diese Integration hat gerade für die Schweiz mit vielen innovativen KMUs enorme Vorteile: Die Spezialisierung auf Nischen mit interessanten Möglichkeiten lohnt sich, es ergeben sich Skaleneffekte. Für konkurrenzfähige Unternehmen – auch wenn sie noch so klein sein mögen – ergeben sich dadurch interessante Geschäftsmöglichkeiten.
Die Beschränkung auf ein erweitertes Freihandelsabkommen verkennt das eherne empirische Gesetz, dass der Grossteil des Handels stets mit den Nachbarn erfolgt. Das ist heute so und wird auch so bleiben, namentlich für die vielen KMUs der Schweiz. Sie sind in erster Linie in den Nachbarstaaten tätig und auf Gleichbehandlung mit Konkurrenten aus andern EU/EWR-Staaten und damit auf unbürokratische Handelsbeziehungen angewiesen. Sie sind mit andern Worten auf die Markteilnahme angewiesen. Der Brexit zeigt, dass heute ein Freihandelsabkommen allein im europäischen Raum nicht genügt und erhebliche Wettbewerbsnachteile mit sich bringt. Das Abkommen mit Grossbritannien enthält sodann weitgehende Regeln zur Unterbindung von Dumping im Sozial-, Umwelt- und Subventionsbereich. Mit diesen Barrieren müsste auch die Schweiz rechnen.
Zweitens werden weitere Freihandelsabkommen mit Drittstaaten vor allem in Asien gefordert, welche die Abhängigkeit vom europäischen Markt reduzieren sollen. Solche Abkommen sind komplementär. Sie leisten einen Beitrag gegen den weltweit zunehmenden Protektionismus und tragen dazu bei, dass Schweizer Unternehmungen auch in den rasch wachsenden Märkten bestehen können. Sie können aber die Teilnahme am europäischen Markt mit heute fast 60 Prozent des schweizerischen Handels und dem Gros der grenzüberschreitenden Investitionen nimmer ausgleichen oder ersetzen. Neben den USA und China entfallen auf die über 30 Freihandelsabkommen der Schweiz lediglich rund 4 Prozent des Handels der Schweiz. Die hochgradig protektionistische Landwirtschaftspolitik reduziert die Attraktivität der Schweiz als Freihandelspartner sodann stark. Sie macht ein Abkommen mit den USA illusorisch. Die Abkommen mit Mercosur und Indien sind noch nicht in trockenen Tüchern, eine Revision des Abkommens mit China ungewiss. Die geopolitische Entwicklung, die Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autokratie begrenzt diese Politik zusätzlich.
Das gilt auch für den multilateralen Rahmen. Fortschritte im Rahmen der WTO werden in einer multipolaren Welt erschwert. Die Entwicklung verortet die Schweiz klar in Europa, wenn man die geopolitischen Herausforderungen einer schrittweisen De-globalisierung in für die Sicherheit kritischen Sektoren berücksichtigt. Der Glaube und die Hoffnung, dass die Schweiz ohne Marktteilnahme am europäischen Binnenmarkt eine erfolgreiche Aussenwirtschaftspolitik aufrechterhalten, gleichzeitig ihre Sicherheit gewährleisten und glaubhaft ohne engen Zusammenhalt mit ihren Nachbarn für ihre Werte und für Demokratie einstehen kann, entbehrt einer realistischen Grundlage.
IV. Institutionelle Einwände
Und gleichwohl sind die Bilateralen III höchst umstritten. Der wirtschaftlichen Notwendigkeit wird entgegengehalten, dass sie die Souveränität der Schweiz und ihre verfassungsrechtliche Ordnung gefährden. Sie unterwerfe sich der EU mit einem Kolonialvertrag ( dazu NZZ vom 20.1.24). Das Parlament verliere die Hoheit über die Gesetzgebung und das Bundesgericht über die Rechtsprechung (dazu NZZ vom 24.1.24). Umstritten sind aus institutioneller Sicht damit die Fragen der dynamischen Rechtsübernahme und der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes (EuGH).
A. Souveränität
Die Debatte um die Souveränität ist in der Schweiz auf die Frage fokussiert, ob sie weiterhin im Sinne des völkerrechtlichen Selbstbestimmungsrechts eigenständig über ihre Gesetzgebung entscheiden kann. Dieses klassische Verständnis orientiert sich ausschliesslich am Nationalstaat. Es greift zu kurz und berücksichtigt den heutigen Grad der internationalen Vernetzung nicht. Souverän ist nicht nur, wer allein entscheidet, sondern wer sie oder ihn betreffende Entscheidungen auch auf den vorgelagerten Stufen des Gemeinwesens beeinflussen kann. Souveränität heute heisst heute vor allem auch Mitsprache und Mitbestimmung. Das wissen im Bund auch die Kantone. Sie nehmen ihre verfassungsrechtliche Souveränität auch durch Mitwirkung auf Bundesebene wahr.
Vermögen die Bilateralen III dem überlieferten wie dem modernen Verständnis der Souveränität gerecht zu werden? Vorauszuschicken ist, dass der freiwillige Abschluss eines Vertrages die Souveränität eines Staates nie verletzt. Die Frage ist, ob der Vertrag diese auf unnötige Weise einschränkt und damit abzulehnen ist. Das entscheidet sich institutionell an den folgenden Aspekten.
B. Die dynamische Rechtsübernahme und die Mitsprache
Die dynamische Rechtsübernahme bedeutet, dass Rechtsanpassungen im Rahmen der neuen Verträge – und nur in deren Geltungsbereich – formell nicht mehr beschlossen werden müssen, sondern unter Vorbehalt des Referendumsrechts übernommen werden. Praktisch bedeutet dies, dass Bundesrat und Parlament ihr Augenmerk auf die Aushandlung der Gesetzgebung in der EU richten müssen. Als Gegenzug zur dynamischen Übernahme wird seitens der EU die Mitsprache bei der Ausarbeitung von Erlassen eingeräumt, wie sie bislang nur im Rahmen von Schengen/Dublin besteht. Sie hat sich hier bewährt. Dank ihr können die Schweizer ihr Sturmgewehr selbst nach Abschluss der Wehrpflicht zu Hause behalten – wohlgemerkt als einziges Land im Schengen-Raum. Die Mitsprache erlaubt es, schweizerische Interessen gezielt einzubringen. Wird sie aktiv und klug wahrgenommen («the power of the pen»), kann die Souveränität über die Landesgrenzen hinaus erweitert werden. Die meisten Regelungsgegenstände fallen dabei in den Kompetenzbereich des Bundesrates und der Departemente. Das Parlament kann aber jederzeit über seine Kommissionen Einfluss nehmen und Interessen zuhanden des Bundesrates artikulieren. Das gleiche gilt auch für die Kantone mittels der Konferenz der Kantonsregierungen.
Eine Untersuchung der Legislatur 2004-2007 hat ergeben, dass in der Schweiz rund 55 Prozent der Gesetzgebung des Bundes vom EU-Recht betroffen ist. Davon wurden bei knapp einem Drittel das EU-Recht ganz, teils durch vertragliche Verpflichtung und teils autonom übernommen. In zwei Dritteln wurde das EU-Recht teilweise, mit helvetischen Modifikationen, übernommen. Gesamthaft wurde das EU-Recht bei rund 15 Prozent aller Gesetzesvorlagen voll übernommen (Jusletter vom 31.8.2009). Die Verhältnisse dürften sich seither nur marginal verändert haben. Für das Verordnungsrecht fehlt eine entsprechende Untersuchung. Hier liegt der Anteil voller Übernahme vor allem in technischen Bereichen viel höher. Die freiwillige Anpassung an das EU-Recht (Europakompatibilität) wird nun in weiteren ausgewählten Teilbereichen mit der dynamischen Übernahme ergänzt und dem Verfahren von Schengen/Dublin angepasst. Sie ist nicht flächendeckend, sondern auf 5 von über 120 Abkommen mit der EU beschränkt. Sie wird durch die Mitsprache bei der Ausarbeitung der Erlasse aufgewogen. Was wegfällt ist die formelle Zustimmung im Einzelfall in Bereichen, wo das Recht bislang autonom oder durch vertragliche Verpflichtung in aller Regel übernommen wurde. Der praktische Unterschied auf dem Terrain wird gering sein, ausser dass die Schweiz ihre Interessen dank der Mitsprache nun frühzeitig einbringen kann.
C. Referendum und Opt-out
Entscheidend ist, dass das Referendumsrecht auch in mit der dynamischen Übernahme vorbehalten bleibt und damit von der Möglichkeit des Opt-out Gebrauch gemacht werden kann, wenn alle Stricke reissen und das Volk eine Vorlage mehrmals ablehnen würde. Die dynamische Rechtsübernahme setzt die Volksouveränität als Selbstbestimmungsrecht nicht ausser Kraft. Revidiert die EU z.B. die Bestimmungen zur Personenfreizügigkeit, unterstehen diese Anpassungen der dynamischen Anpassung im Rahmen des bilateralen Vertrages, d.h. ohne die Komponenten der Unionsbürgerschaft. Diese Anpassungen erfolgen ohne weiteres, unterstehen aber dem Referendum. Referenden werden es nicht schwieriger haben als bei anderen Vorlagen, wo die internationale Vernetzung eine wichtige Rolle spielt und die Ablehnung der Vorlage mit grossen Nachteilen verbunden ist. Das Volk kann die Anpassung aber ablehnen und nach Verhandlungen und allenfalls einem Schiedsverfahren Ausgleichsmassnahmen in Kauf nehmen. Diese Einschränkungen werden durch die aktive Mitsprache bei der Ausarbeitung der europäischen Gesetzgebung ausgeglichen. Es liegt an der Schweiz, diese zu nutzen und ihre Mitspracherechte souverän wahrzunehmen. Gesamthaft ist die Gleichung fair und ausgeglichen. Sie ist gegenüber der Guillotine Klausel der Bilateralen I klar eine Verbesserung.
D. Die Rolle des Schiedsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes
In der Anwendung der bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU/EWR-Staaten haben der EuGH für Klagen Privater in den Mitgliedstaaten, und das Bundesgericht für Klagen in der Schweiz das letzte Wort. Die Bilateralen III führen neu für zwischenstaatliche Streitigkeiten – und nur dort – ein Schiedsverfahren ein. Ein solches besteht bislang nur im Versicherungsabkommen und dem Abkommen zur Erleichterung des Zollverfahrens. Es wurde noch nie gebraucht. Denn Lösungen werden in erster Linie in den gemischten Ausschüssen erarbeitet. Die neue Gerichtsbarkeit kann indessen Blockaden vermeiden, wie sie beispielsweise den Holding-Steuerstreit mit der EU über Jahre charakterisierten. Es verhindert auch, dass Gegenmassnahmen willkürlich ohne sachlichen Kontext getroffen werden. Eine gegen über Drittstaaten diskriminierende Verweigerung der Börsenaequivalenz oder die Aussetzung von Forschungsprogrammen sind so rechtlich ohne festgestellte Vertragsverletzung nicht mehr möglich. Die Rule of Law wird gestärkt und die Schweiz gewinnt damit an Souveränität. Sie kann sich mit einem Schiedsverfahren wehren und die Verhältnismässigkeit von Ausgleichsmassnahmen seitens der EU durchsetzen. Sie erhält mit den Bilateralen III ein zusätzliches Instrument zur Durchsetzung der eigenen Interessen auf dem Rechtsweg. Das ist ein entscheidender Fortschritt gegenüber heute und verdient in der Debatte wie die Mitsprache eine viel stärkere Beachtung.
Das Schiedsgericht entscheidet allein über die Auslegung der völkerrechtlichen Bestimmungen der Bilateralen III und über die Verhältnismässigkeit von Ausgleichsmassnahmen. Es hat keine Kompetenz, Bussgelder zu verhängen. Es ist rechtlich schon aus diesem Grunde unrichtig, das Schiedsverfahrens als Durchlauferhitzer und Vorstufe für den EuGH darzustellen. Denn der Gerichtshof kommt in diesem Verfahren nur zum Zuge, wenn eine Frage des EU-Rechts noch unklar ist und nicht bereits Präjudizen zur Sache vorliegen. Im Vorlageverfahren sind alle EU-Mitgliedstaaten beteiligt. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, die für alle Mitgliedstaaten massgeblich ist. Die Streitfrage betrifft so nicht allein die Schweiz. Sie ist Partei unter vielen. Dem Gerichtshof steht die abschliessende Kompetenz zur Auslegung des EU-Rechts zu. Wird diese nicht gewahrt, wird er weiteren Verträgen mit der Schweiz in einem Gutachterverfahren schlicht nicht zustimmen.
Das Bundesgericht erleidet mit dem Schiedsverfahren keinen Machtverlust. Es unterliegt bereits heute internationalen Gerichten, so dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und den WTO-Streitbeilegungsorganen. Die europäische Menschenrechtskonvention hat die Stellung des Bundesgerichts gestärkt, indem das Bundesgericht auch Bundesgesetze in der Anwendung auf die Vertragskonformität überprüft. Das gleiche macht es in Bezug auf die bilateralen Verträge und kann dies ebenso in Bezug auf das WTO-Recht und andere Verträge tun. Die Bilateralen III sehen kein Verfahren vor, bei dem der EuGH im Vornherein um Klärung des EU Rechts gebeten werden muss, wie dies für die Gerichte der Mitgliedstaaten gilt. Das Bundesgericht wird weiterhin im Dialog mit dem EuGH nach kompatiblen Lösungen suchen. Denn auch es ist an den Grundsatz pacta sunt servanda gebunden und Konflikte mit dem EU-Recht so weit wie vermeiden. Und sollte es gleichwohl einmal abweichen, so greift neu die Möglichkeit eines Schiedsverfahrens und eines Opt-out, unter Inkaufnahme von verhältnismässigen Ausgleichsmassnahmen.
V. Respekt der direkten Demokratie der Schweiz
Die Europäische Union berücksichtigt in den Bilateralen III die zentrale geographische Lage der Schweiz. Sie respektiert deren wirtschaftliche Bedeutung, und die Rechtstaatlichkeit. Sie zollt aber vor allem den direkt-demokratischen Institutionen der Schweiz Respekt. Die Bilateralen III sind eine sinnvolle Weitentwicklung einer langjährigen Partnerschaft auf Augenhöhe und gegenseitiger Achtung. Die Schweiz muss anerkennen, dass die EU und die mächtigen Mitgliedstaaten nach dem Rückzug des Beitrittsgesuches und der Verwerfung des Rahmenabkommens ihr stark entgegenkommen und zu einer massgeschneiderten Lösung Hand bieten. Die Haltung der Union widerspricht den landläufigen Vorstellungen einer dogmatischen, jakobinischen EU-Kommission. Ein Kolonialvertrag liegt mitnichten vor. Das ist reine Polemik und Angstmacherei, die das Volk mit Blick auf die nächsten Wahlen an der Nase herumführen will. Sie hat keine sachliche Grundlage. Die Bilateralen III unterliegen der direkten Demokratie. Das Vertragswerk basiert auf Zustimmung. Die Schweiz könnte es durch einen souveränen Beschluss wieder beenden. Imperialismus und Kolonialismus sind etwas ganz Anderes. Es genügt, die Ziele Russlands in der Ukraine oder die Politik Chinas gegenüber Taiwan und im südchinesischen Meer in Erinnerung zu rufen.
Als die nach Luxembourg am stärksten in den europäischen Binnenmarkt integrierte Wirtschaft geniesst die Schweiz auch unter den Bilateralen III eine aussergewöhnliche Selbständigkeit, um die sie die Mitgliedstaaten beneiden mögen. Sie kann notfalls weiterhin ihre eigenen Vorstellungen unter Inkaufnahme von Ausgleichsmassnahmen rechtlich durchsetzen. Ihre Souveränität wird gewahrt und durch Mitsprache gestärkt. Die Bilateralen III versprechen ein faires Bündnis.
*Thomas Cottier ist emeritierter Professor für Europa- und Wirtschaftsvölkerrecht an der Universität Bern, Präsident der Vereinigung La Suisse en Europe. Der Autor dankt Jan Atteslander, Jean-Daniel Gerber, Martin Gollmer, Matthias Oesch und Daniel Woker für wertvolle Anregungen.