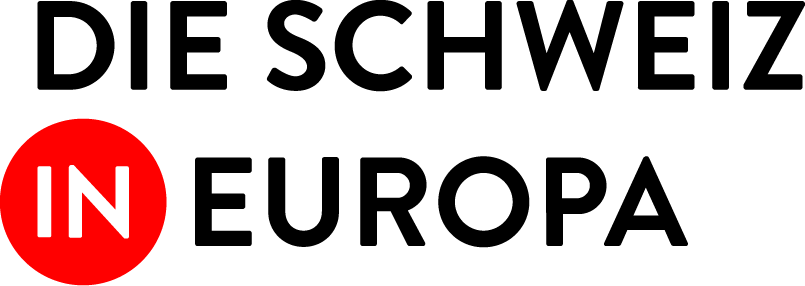Es scheint, als hätten mit der Ernennung von Jean-Daniel Ruch zum Staatssekretär für Sicherheitspolitik diejenigen Kräfte in Bundesbern gewonnen, die zur EU und zur Nato auf Distanz bleiben und an der traditionellen Neutralität festhalten wollen.
Das war eine dicke Überraschung: Am Freitag, 15. September 2023, wählte der Bundesrat nicht die Favoritin Pälvi Pulli, die Chefin Sicherheitspolitik im Verteidigungsdepartement, an die Spitze des neu geschaffenen Staatssekretariats für Sicherheitspolitik (Sepos), sondern den weitgehend unbekannten Karrierediplomaten Jean-Daniel Ruch.
Die umtriebige, ursprünglich aus Finnland stammende Pulli gilt in Bundesbern als Internationalistin. Sie steht für die Formel «Sicherheit und Kooperation». Sie will so viel sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten, der EU und der Nato wie möglich. Die Neutralität der Schweiz soll dabei nur so weit wie unbedingt nötig berücksichtigt werden. Das dürfte einer Mehrheit im Bundesrat und rechts-nationalen Politikkreisen nicht behagt haben.
Ruch gemässigter als Pulli
Ruch ist dagegen nicht so forsch wie Pulli, er ist stromlinienförmiger. Der aus Moutier stammende altgediente Botschafter mit Posten von Belgrad über Tel Aviv bis Ankara lancierte seine Karriere Ende der 1980er-Jahre im damaligen Militärdepartement in der Zentralstelle für Gesamtverteidigung. Die Stelle habe viel Gemeinsames gehabt mit dem Staatssekretariat für Sicherheitspolitik, sagte der 60-jährige Ruch bei der Präsentation durch Verteidigungsministerin Viola Amherd. Will heissen, dass sich das Sepos nicht nur schwergewichtig mit internationaler Kooperation befassen wird, sondern auch mit Ereignissen wie Stromausfällen in der Schweiz oder Cyberattacken aus dem Ausland.
Obwohl die Neutralität heute von manchen angezweifelt wird, misst Ruch ihr grossen Wert bei. Er bezeichnet sie bei seiner Präsentation als «Soft Power der Schweiz». Er habe während seiner diplomatischen Karriere mehrmals Dinge tun können, die nur dank der Neutralität möglich geworden seien. So etwa im Nahen Osten, wo er einst als Sonderbeauftragter der damaligen Aussenministerin Micheline Calmy-Rey unterwegs war. Mit dieser Haltung dürfte Ruch bei einer Mehrheit der Landesregierung auf Anklang gestossen sein. Auch im nationalkonservativen politischen Lager dürfte man damit zufrieden sein.
Wie dem auch sei: Man soll den Stab nicht zu früh über Ruch brechen; er soll erst einmal im Amt beweisen können, wie er denkt und handelt. Dennoch wird man den Eindruck nicht los, dass mit der Ernennung Ruchs diejenigen Kräfte in Bundesbern gewonnen haben, die zur EU und zur Nato auf möglichst grosser Distanz bleiben und an der hergebrachten Neutralität festhalten wollen.
Mehr Kooperation notwendig
Dabei bräuchte die Schweiz mehr Kooperation mit der EU und der Nato in sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen. Den meisten Schweizerinnen und Schweizern ist nämlich inzwischen klar, dass sich die Schweiz bei einem militärischen Angriff aus dem Ausland nur kurze Zeit selbst verteidigen kann. Namhafte Politiker wie etwa FDP-Präsident Thierry Burkart haben denn auch für eine engere Kooperation insbesondere mit der Nato plädiert. Deren Abwehrdispositiv gegen einen feindlichen Angriff auf dem Boden oder in der Luft auf ihr Gebiet in Europa schützt jetzt schon auch die Schweiz mit. Es wäre deshalb an der Zeit, wenn auch die Schweiz ihren Beitrag an diese Verteidigungsbemühungen leisten würde.
Allein, die Neutralität der Schweiz verhindert wohl einen substanziellen Beitrag an diese Bemühungen. Die Neutralität erweist sich damit im heutigen Europa, dessen Sicherheitsarchitektur seit der russischen Aggression gegen die Ukraine in Trümmern liegt, immer weniger als wirkungsvoller Schutz vor einem militärischen Angriff auf die Schweiz. Vielmehr verhindert die Neutralität eine weitgehende Kooperation mit der EU und der Nato zum umfassenden Schutz der Schweiz im Kriegsfall. Der neue Staatssekretär für Sicherheitspolitik Ruch wird sich auch an solchen Überlegungen messen lassen müssen.