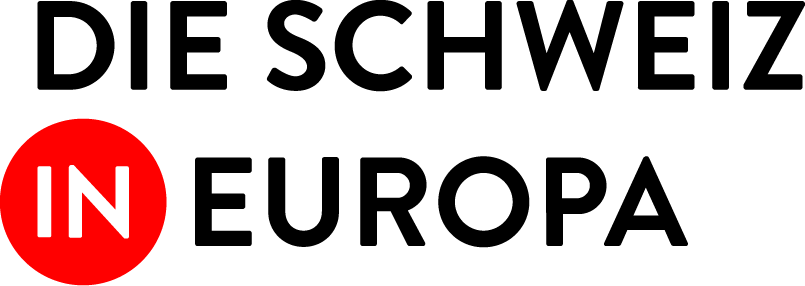Blocher – ein polternder Populist von Daniel Woker
In seiner Albisgüetli-Abschiedsrede vom Freitag, 19. Januar 2024, hat Altbundesrat Christoph Blocher einmal mehr seine üblichen Aussagen zu EU und Migration wiederholt, die voll von Verdrehungen und Unwahrheiten sind.
In einem langen Interview in den Tamedia-Zeitungen vom Wochenende vom 13./14. Januar 2024 spielte der Milliardär Christoph Blocher den Beschützer der Heimat mit Herz für die Armen: «Ich wäre …. sogar für eine 14. AHV-Rente». Seine darauf folgenden Aussagen zu EU und Migration, die er im Albisgüetli schlagwortartig wiederholte, zeigen aber, was er war und bleibt: ein polternder Populist – auch in seiner letzten Rede.
Unnötig? Kolonialvertrag? Einfach?
Eine Einigung mit der EU, wie sie mit den kommenden Verhandlungen über die zukünftige Gestaltung des Verhältnisses der Schweiz zur EU (Bilaterale III) allenfalls zu Stande kommt, sei ein «unnötiger Kolonialvertrag, Sachprobleme mit der EU könnten mit einem einfachen Abkommen geregelt werden». Das sind gleich drei Unwahrheiten hintereinander. Der Vertrag ist bitter nötig, um der Schweiz den Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu erhalten. Das befürwortet gemäss Umfragen eine Mehrheit von Schweizerinnen und Schweizer.
Die Schweiz als Kolonie der EU, also von Deutschland, Frankreich, Italien und anderen europäischen Staaten, die uns politisch und wirtschaftlich am nächsten stehen? Diese zweite Unwahrheit ist einfach lächerlich. Blocher will wohl ein Alpenmonaco, in dem Reiche aus aller Welt sowie gewisse Banken und Finanzunternehmen profitieren, die grosse Mehrheit der Bevölkerung aber leiden würde. Wirtschaftlich beispielsweise unter erhöhten Importpreisen und der Abschnürung unserer bi- und trinationalen Grenzregionen von ihrem europäischen Hinterland, politisch unter einer weiteren Entfremdung des europäischen Kernlandes Schweiz von Europa.
Die dritte Unwahrheit vom «einfachen Vertrag» ist von bodenloser Frechheit. Es war nämlich Blocher, der 1992 mit einer millionenschwerer Schmutzkampagne gegen den Beitritt der Schweiz zum EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) die Volksabstimmung zum Kippen ins knappe Nein brachte. Das wäre eine einfache Lösung für den Zugang zum EU-Binnenmarkt gewesen. Seither sind zwar Notlösungen gefunden worden, was nun aber zu Ende ist. Für einen Vertrag braucht es zwei Seiten; die EU hat seit Jahren das Ende von Notlösungen signalisiert.
Unreflektiertes vom Biertisch
Blochers im Interview weiter enthaltene Beschimpfung der «classe politique, welche die lästigen Volksabstimmungen und das Kantonsmehr (Ständemehr) beseitigen» will, ist sein übliches Echo vom unreflektierten Biertisch. Dass die beiden SVP-Bundesräte Guy Parmelin und Albert Rösti ohne Beschluss der Gesamtregierung in ihren internationalen Kontakten am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos die These vom doppelten Mehr, also einer Mehrheit von Volk und Kantonen, bei der kommenden Volksbefragung über die Bilateralen III vertreten haben, wiegt schwerer. Das geht in Richtung Befehlsempfang aus Herrliberg für Minister, die unabhängig von ihrer Partei gemäss dem Wohl des Landes entscheiden sollten. Die Bilateralen I und II sind beide dem einfachen Referendum unterstellt worden, da darin keine Veränderung der Bundesverfassung – Grundvoraussetzung des obligatorischen Referendums mit doppeltem Mehr – vorgesehen war, was auch auf die Bilateralen III zutreffen wird.
Die EU brauche «Geld, Geld, Geld», behauptet Blocher weiter. Er meint damit den Kohäsionsbeitrag, der mit den Bilateralen III auf eine solide Basis gestellt werden soll. Die Schweiz leistet diesen Beitrag seit Jahren, um zum Ausgleich zwischen West und Ost im EU-Binnenmarkt beizutragen. Dies auch in unserem eigenen Interesse, ist doch gerade die exportabhängige Schweiz auf prosperierende Märkte angewiesen. Es handelt sich um Mittel, die für das Wohl Gesamteuropas eingesetzt werden. An dessen Stärkung muss sich in diesen Zeiten von europäischen (Ukraine) und globalen geopolitischen Verwerfungen auch das Nichtmitglied Schweiz, das nichts für das reguläre EU-Budget leistet, beteiligen.
Geld braucht die EU tatsächlich für die Bewältigung der grossen Zukunftsprobleme: Klimawandel, Regulierung von Technologie, sicherheitspolitische Probleme mit einem Make-America-Great-Again-Präsidenten Trump in den USA, illegale Immigration. Alles Probleme, die auch die Schweiz betreffen, und die wir in enger Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern besser und kostengünstiger regeln als allein.
Angriff auf die Personenfreizügigkeit
«Arbeitskräfte finden wir auch ohne Personenfreizügigkeit», meint Blocher weiter. Das ist zumindest eine grobe Verdrehung. Gerade die Personenfreizügigkeit im EU-Binnenmarkt, der sich die Schweiz mit dem bilateralen Freizügigkeitsabkommen von 1999 (FZA) angeschlossen hat, garantiert, dass die gesuchten, qualifizierten Fachkräfte, die wir dringend benötigen, ohne administrative Probleme gefunden werden können. Denn diese kommen primär aus der EU. Die SVP-Initiative gegen das FZA (Begrenzungsinitiative) haben Volk und Stände 2020 mit über 60 Prozent Nein-Stimmen verworfen.
In diesem wichtigen Bereich der nun abgeschlossenen Vorverhandlungen zwischen der Schweiz und der EU für die Bilateralen III konnten bereits die Umrisse von fairen Kompromissen zwischen allgemeinen EU-Regelungen und spezifisch schweizerischen Bedürfnissen gefunden werden. So insbesondere beim Lohnschutz, der Sozialhilfe und dem Landesverweis bei Strafverfahren.