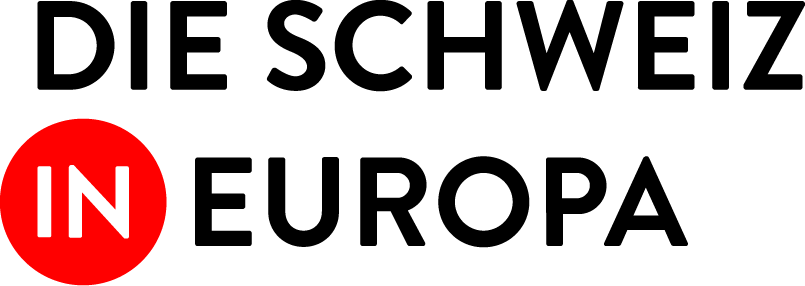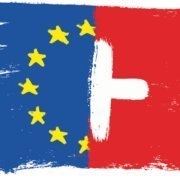Bauern und Europa-Blinde von Daniel Woker
Bald könnte die schweizerische Regierung fünf Vertreter mit Landwirtschaftshintergrund, aber offensichtlich nur einen klarsehenden Europäer aufweisen. Bauernstaat Schweiz, freischwebend als Neutrum im Weltall?
Abgesehen von den SVP-Bundesräten Guy Parmelin und Albert Rösti haftet auch die beiden SP-Regierungsmitglieder ein Hauch von Stallgeruch an: Beat Jans in seiner Ausbildung, Elisabeth Baume-Schneider als Halterin von Schwarznasen-Schafen, was ihr, Berichten gemäss, entscheidende bäuerliche Stimmen beim Sieg über Konkurrentin Eva Herzog eingebracht habe. Bauernpräsident Markus Ritter befinde sich, so Insider aus dem Bundeshaus, heute auf geradem Weg in die Landesregierung.
Einem Interview mit der Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter ist zu entnehmen, wie wenig ihr die europäische Verankerung der Schweiz bedeutet. Bislang scheint nur Jans bereit, Herzblut für die letzte Brücke der Schweiz zum EU-Europa, die erfolgreich ausgehandelten Bilateralen III, zu vergiessen.
Goldene Zeiten für Agrarsubventionen
Ritter findet, dass Bauern, im Gegensatz zu Juristen, doch den ganzen Tag und jeden Tag aktiv tätig seien. Dies, wie er noch vor kurzem mit Zipfelmütze auf erhobenem Haupt verkündete, zu sehr geringem Lohn. Damit wird klar, dass künftig Agrarsubventionen im Bundesrat von Beginn weg auf drei Stimmen zählen können, Schuldenbremse hin oder her.
Dies in einem Land mit einem tiefen einstelligen Prozentsatz der arbeitenden Bevölkerung in der Landwirtschaft, das aber für seinen Wohlstand geradezu verzweifelt auf intakte internationale Kontakte angewiesen ist – etwa mit Blick auf Handelsaustausch und qualifizierte Arbeitskräfte, ebenso wie im Tourismus sowie in Forschung und Ausbildung.
Immerhin dürfte die Wahl von Ritter das von schweizerischen Europagegnern als Alternative zum EU-Binnenmarkt angepriesene Freihandelsabkommen mit den USA weiter in die Ferne rücken. Ein solches ist, wenn überhaupt, nur zum Preis von höheren amerikanischen Lebensmittelimporten erhältlich. Was gerade in einem Bauernstaat Schweiz unmöglich erscheint. Dessen parlamentarische Hauptvertretung traf sich am vergangenen Wochenende in Balsthal.
Die SVP trump(ft) in Balsthal auf
Vom Altmeister der Europhobie und EU-Verteufelung, Alt- Bundesrat Christoph Blocher, war anlässlich der SVP-Delegiertenversammlung nichts anderes zu erwarten als die alte Lügen-Leier vom Kolonialvertrag, die er einmal mehr vortrug. Bekanntlich versuchen nacheifernde Epigonen – wie etwa Vizepräsident James David «JD» Vance in den USA oder auch Ex-Präsident Dimitri Medwedew in Russland – jeweils den grossen Führer an Radikalität noch zu übertrumpfen. So in Balsthal Nationalrat Marcel Dettling, als Präsident der SVP einer der Nachfolger von Blocher, der als Politclown auftrat, ausgerüstet mit Hellebarde, Peitsche und Gesslerhut-Vergleich, um die Emotionen gegen Brüssel im Volk weiter anzuheizen.
Ausgerechnet Gessler, ein Tribun der Habsburger, welche ursprünglich Schweizer waren, dann Österreicher in einem Land, in dem im Moment ein rechter und rabiater Europagegner die Macht zu übernehmen droht. Allerdings dürfte es sich lediglich um eine Frage der Zeit handeln bis Alt-SVP-Nationalrat Roger Köppel, schweizerisches Vorstandsmitglied in der Internationale der Rechten Reaktion, auch der schweizerischen Anti-EU Kampagne mit einem Kick(l) weiter Schwung zu geben versucht.
Das ganze unwürdige Schauspiel in Balsthal – ein direkter Affront gegenüber unseren europäischen Partnerländern, welche alle die angeblich die Peitsche schwingende EU verkörpern – kam von Seiten der wählerstärksten Partei der Schweiz. Die mit zwei Vertretern in der Landesregierung sitzt, welche bislang weder ein abschließendes Urteil über den erfolgreich ausgehandelten Vertrag der Bilateralen III, noch über die Art der Verabschiedung – einfaches Volksmehr oder doppeltes Mehr von Volk und Ständen – gefällt hat.
Die Bundespräsidentin bleibt ambivalent
In einem grossen Interview in allen Tamedia-Medien hat es Bundespräsidentin Keller-Sutter unterlassen, genau hier Klartext zu sprechen. Sie erwähnt lediglich die letzte Entscheidung über die Bilateralen III durch das Volk, ohne zu präzisieren, dass Gesetz und Praxis klar sind: ein einfaches Volksmehr genügt.
Auch anderes, was sie im Interview sagt oder eben gerade nicht sagt, lässt aufhorchen. Mit Präsident Wolodimir Selenski habe sie am WEF in Davos über die Möglichkeit der neutralen Schweiz als Begegnungs- oder gar Verhandlungsort eines Friedens zwischen der Ukraine und Russland gesprochen. Kein Wort zum auf Seiten Europas und – zumindest bis zur Präsidentschaft von Donald Trump – des ganzen Westens bislang geforderten «gerechten Frieden». Ein Friede, der den ruchlosen Aggressor Wladimir Putin nicht noch belohnt und ihm damit Appetit für weitere Vorstösse nach Westen macht. Als wäre die Schweiz, jedenfalls eine klare Mehrheit aller Schweizerinnen und Schweizer, nicht ebenso empört und betroffen wie andere Europäer angesichts des russischen Revisionismus.
Die Bilateralen III habe die Schweiz «für die Wirtschaft» ausgehandelt, so Keller-Sutter weiter. Dafür «Begeisterung zu zeigen», sei nicht die Aufgabe des Bundesrates. Allenfalls sollten ihr Nachhilfestunden in zeitgenössischer Schweizer Geschichte gegeben werden: Aussenpolitische Vorlagen wie die Bilateralen III müssen von unseren Regierungsmitgliedern mit Herzblut in allen Teilen der Schweiz vertreten werden, so von Keller-Sutter ganz speziell im eher konservativ und bäuerlich geprägten Osten. Wie dies Beat Jans im nördlichen Grenzkanton Basel tun wird. Sonst haben sie keine Chance beim Stimmvolk.
Und nein, die Bilateralen III will und braucht die Schweiz nicht «nur» wegen der Wirtschaft, sondern ebenso wegen ihrer politischen und emotionalen Brückenfunktion mit unserem Heimatkontinent Europa. Oder wie das Schriftsteller Peter von Matt glasklar ausgedrückt hat: «Unsere Heimat ist die Schweiz, aber die Heimat der Schweiz ist Europa».