Bilaterale III: Chance packen! Von Martin Gollmer
Der Bundesrat hat dem dritten bilateralen Vertragspaket mit der EU zugestimmt und es in die Vernehmlassung geschickt. Alle Dokumente der Bilateralen III sind jetzt öffentlich. Damit kann eine faktenbasierte Diskussion beginnen. Eine erste Übersicht zeigt: Die Schweiz hat gut verhandelt, auch wenn sie ein paar Kröten schlucken musste. Parlament und Volk sollten die Chance, das Verhältnis zur EU stabilisieren und weiterentwickeln zu können, packen und den Bilateralen III zustimmen und nicht auf die Polemik eines Unterwerfungsvertrags und Souveränitätsverlusts hereinfallen. Im Gegenteil: Die Stellung der Schweiz in Europa wird mit dem Paket gestärkt.
Wenn das nur kein schlechtes Omen ist! Ausgerechnet an einem Freitag, den 13. (Juni 2025) hat der Bundesrat das neue, dritte bilaterale Vertragspaket zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU) gutgeheissen und in die Vernehmlassung geschickt. Bis zum 31. Oktober 2025 haben jetzt Parteien, Verbände, Kantone und weitere Kreise Zeit, zum Paket Stellung zu nehmen. Die Stellungnahmen werden in die definitive Botschaft einfliessen, die der Bundesrat voraussichtlich im 1. Quartal 2026 dem Parlament zur Beratung zuleiten wird.
Alle Dokumente zu den Bilateralen III, wie das Paket hier kurz und einfach genannt wird, sind jetzt öffentlich. Dazu gehören die Abkommen mit der EU selbst, die Massnahmen zu deren innerstaatlicher Umsetzung in der Schweiz (dabei sind 95 EU-Rechtsakte relevant, 32 Bundesgesetze müssen angepasst und drei neu erlassen werden) sowie die Erläuterungen dazu. Insgesamt kommen so Texte im Umfang von über 1800 Seiten zusammen. Wir fassen für Sie im Folgenden die wichtigsten Inhalte und Errungenschaften aus Schweizer Sicht zusammen:
- Die Bilateralen III stabilisieren den hindernisfreien Zugang der Schweiz zu Teilen des EU-Binnenmarkts und entwickeln ihn weiter. Das ist wichtig für ein Land, das über keine Rohstoffe und selbst nur über einen kleinen Binnenmarkt verfügt. Der EU-Binnenmarkt ist mit rund 450 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten der weltgrösste grenzüberschreitende Markt mit einheitlichen Regeln.
- Die dynamische Übernahme von EU-Recht durch die Schweiz schafft im Bereich der betroffenen Verträge Rechtssicherheit im Verkehr zwischen der Schweiz und der EU. Sie stellt sicher, dass jederzeit die gleichen Gesetze zu beiden Seiten der Grenzen der zwei Vertragsparteien gelten. Dynamisch heisst nämlich, dass EU-Recht durch die Schweiz fortlaufend und ohne Verhandlungen durch die Schweiz übernommen wird anstatt nur periodisch im Rahmen von Verhandlungen wie bisher. Der Bundessrat, das Parlament und gegebenenfalls das Volk können dabei aber weiterhin entscheiden, ob sie eine EU-Regelung übernehmen wollen oder nicht. Dynamisch heisst also nicht automatisch. Der normale demokratische Entscheidungsprozess in der Schweiz bleibt somit gewahrt. Sagt die Schweiz einmal Nein zur Übernahme eines EU-Gesetzes, kann die EU zur Wiederherstellung des Vertragsgleichgewichts Ausgleichsmassnahmen ergreifen. Diese müssen aber verhältnismässig sein. Ob das der Fall ist, überprüft gegebenenfalls ein paritätisch zusammengesetztes Schiedsgericht. Die dynamische Rechtsübernahme gilt nur im Bereich von bestehenden bilateralen Abkommen, die der Schweiz Zugang zum EU-Binnenmarkt gewähren. Betroffen sind durch die Bilateralen III die Bereiche Personenfreizügigkeit, Produktzulassung (technische Handelshemmnisse), Agrarprodukte, Land- und Luftverkehr. In diesen Bereichen erhält die Schweiz bei der Vorbereitung von EU-Recht neu eine Mitsprachemöglichkeit. Das sind wesentliche Verbesserungen.
- Ein neues Streitbeilegungsverfahren schützt den kleineren und schwächeren Vertragspartner, also die Schweiz, vor Machtmissbrauch und Willkür durch den grösseren und stärkeren, hier die EU. Streit wird dabei zuerst in einem aus Diplomaten der beiden Seiten zusammengesetzten Gemischten Ausschuss behandelt. Gibt es in diesem Ausschuss keine Einigung, kann ein paritätisch aus je einem Richter der beiden Vertragsparteien bestehendes Schiedsgericht mit einem unabhängigen Präsidenten beigezogen werden. Dieses Schiedsgericht muss, wenn die Auslegung von EU-Recht strittig ist, den Europäischen Gerichtshof (EuGH) konsultieren. Dessen Rechtsauslegung ist für alle Mitgliedstaaten der EU, des EWR und auch das Schiedsgericht bindend. Danach entscheidet das Schiedsgericht den Streitfall abschliessend, wobei es noch weitere Erwägungen in sein Urteil einbeziehen kann. Der EuGH legt nur EU-Recht aus, für die Interpretation der bilateralen, völkerrechtlichen Verträge, z.B. die Schutzklausel, ist das Schiedsgericht allein zuständig. Für die Auslegung des schweizerischen Rechts bleiben weiterhin allein schweizerische Gerichte inklusive des Bundesgerichts zuständig. Sie berücksichtigen dabei das Europarecht. Die Bilateralen III bringen also keine «fremden Richter» in die Schweiz.
- Im Bereich der Personenfreizügigkeit stellen die Bilateralen III sicher, dass die Zuwanderung aus der EU in die Schweiz weiterhin an den Nachweis einer Erwerbstätigkeit gebunden ist. Ein Daueraufenthaltsrecht erhalten EU-Bürgerinnen und -Bürger nur, wenn sie mindestens fünf Jahre in der Schweiz gearbeitet haben. So kann eine allfällige Zuwanderung aus der EU in das schweizerische Sozialversicherungssystem eng begrenzt werden. Die so geregelte Personenfreizügigkeit erlaubt es schweizerischen Arbeitgebern ohne grosse bürokratische Hindernisse Arbeitskräfte in der EU zu rekrutieren. Damit kann der hiesige Arbeits- und Fachkräftemangel ein Stück weit gelindert werden. Sollte die Zuwanderung aus der EU zu grossen wirtschaftlichen und/oder sozialen Problemen führen, kann die Schweiz eine Schutzklausel aktivieren. Der Bundesrat hat bereits Kriterien in den Bereichen Bevölkerung, Wirtschaft und Sozialwesen definiert, bei deren Überschreiten die Schutzklausel ausgelöst werden soll. Will die Schweiz die Schutzklausel aktivieren, muss sie die EU zuerst im Gemischten Ausschuss und danach gegebenenfalls im Schiedsgericht konsultieren. Ergreift die Schweiz mit oder ohne Zustimmung dieser Gremien Massnahmen zur Begrenzung der Zuwanderung, kann die EU zur Wiederherstellung des Vertragsgleichgewichts verhältnismässige Ausgleichsmassnahmen treffen. Die Präzisierung der Schutzklausel in den Bilateralen III ist auch als Reaktion des Bundesrats auf die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» der SVP zu verstehen. Diese würde unter Umständen die Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU notwendig machen und so den gesamten bilateralen Weg der Schweiz in Frage stellen.
- Im Bereich des Lohnschutzes für schweizerische Arbeitnehmer wurde in den Bilateralen III das Prinzip «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort» verankert. Von EU-Unternehmen in die Schweiz entsandte Arbeitskräfte müssen also nach hiesigen Ansätzen entschädigt werden. Allerdings gilt eine Ausnahme: Spesen müssen nur nach den Ansätzen im Herkunftsland der entsandten Arbeitskräfte ausgerichtet werden. Diese Regelung, die auch in der EU umstritten ist, verschafft den ausländischen Unternehmen einen leichten Wettbewerbsvorteil in der Schweiz. Das bereitet vor allem den hiesigen Gewerkschaften Sorgen; sie drohen deshalb, das ganze dritte bilaterale Vertragspaket abzulehnen.
- Die Bilateralen III bringen auch eine systematischere Teilnahme der Schweiz an den EU-Programmen für Forschung, Bildung, Jugend, Sport und Kultur. Im Vordergrund steht die Beteiligung an den Forschungs- und Bildungsprogrammen. Von diesen war die Schweiz ausgeschlossen worden, nachdem der Bundesrat 2021 einseitig die Verhandlungen mit der EU über ein institutionelles Rahmenabkommen zu den bilateralen Verträgen abgebrochen hatte. Beim Forschungsprogramm «Horizon Europe» kann die Schweiz jetzt auf provisorischer Basis wieder mitmachen, nachdem die Verhandlungen mit der EU über die Bilateralen III erfolgreich abgeschlossen wurden. Definitiv wird die Teilnahme erst, wenn die Schweiz die institutionellen Bestimmungen der Bilateralen III (dynamische Rechtsübernahme, Streitbeilegung usw.) in einer Volksabstimmung akzeptiert hat. «Horizon Europe» ist mit einem Budget von 95,5 Milliarden Euro für die Periode 2021 bis 2027 das weltgrösste Forschungsprogramm seiner Art. Forschung und stetige Innovation sind für ein Land wie die Schweiz, das über keine eigenen Rohstoffe verfügt, für den wirtschaftlichen Erfolg enorm wichtig.
- Die Bilateralen III umfassen neben einer Modernisierung und Dynamisierung bestehender bilateraler Abkommen auch neue bilaterale Verträge in den Bereichen Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit. Das Wichtigste ist dabei das Stromabkommen, weil es bedeutende Veränderungen im schweizerischen Strommarkt bringen wird. Das Abkommen ermöglicht es der Schweiz einerseits gleichberechtigt und hindernisfrei am europäischen Strombinnenmarkt teilzunehmen. Das ist für Netzstabilität, Versorgungssicherheit und Krisenvorsorge in der Schweiz wichtig. Als Gegenleistung muss die Schweiz andererseits den heimischen Strommarkt öffnen: Endverbraucher können dabei den Stromlieferanten frei wählen, in der Grundversorgung mit regulierten Preisen bleiben oder in diese zurückkehren (unter Inkaufnahme von Wechselgebühren). Weil in einem freien Strommarkt Wettbewerb unter den Stromlieferanten herrscht, dürften die Strompreise sinken. Der Bundesrat hat bereits Massnahmen angekündigt zum Schutz der Konsumenten in einem solchen Markt. Wichtig: Das Stromabkommen erlaubt es der Schweiz über die Nutzung der Wasserkraft weiterhin selbst zu entscheiden. Der Fortbestand der zahlreichen kleinen Kraftwerke ist nicht gefährdet. Denn die Netzgebühren bleiben ihnen auf jeden Fall als stabile Einnahmequelle auch in einem liberalisierten Markt.
- Im Rahmen der Bilateralen III trägt die Schweiz schliesslich mit einem sogenannten Kohäsionsbeitrag zur Verringerung wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten in der EU bei. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur politischen und wirtschaftlichen Stabilität in Europa. Der Kohäsionsbeitrag beträgt 350 Millionen Franken pro Jahr und kommt direkt ausgewählten EU-Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa zugute. Bisher betrug dieser Betrag 130 Millionen Franken pro Jahr. Er ist wesentlich tiefer als die Beiträge als Mitgliedstaat der EU oder des EWR.
Im Rahmen der Bilateralen III trägt die Schweiz schliesslich mit einem sogenannten Kohäsionsbeitrag zur Verringerung wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten in der EU bei. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur politischen und wirtschaftlichen Stabilität in Europa. Der Kohäsionsbeitrag beträgt 350 Millionen Franken pro Jahr und kommt direkt ausgewählten EU-Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa zugute. Bisher betrug dieser Betrag 130 Millionen Franken pro Jahr. Er ist wesentlich tiefer als die Beiträge als Mitgliedstaat der EU oder des EWR.
Bevölkerung positiv eingestellt
Die Schweizer Stimmbevölkerung steht den Bilateralen III seit langem gemäss Umfragen mehrheitlich positiv gegenüber. In einer neueren Umfrage von gfs.bern für den Branchenverband Interpharma vom Januar 2025 sagten 64 Prozent der Befragten, sie seien mit dem Vertragspaket «voll oder eher einverstanden». 28 Prozent waren «eher nicht oder gar nicht einverstanden». 8 Prozent erklärten sich unentschieden. Im März 2025 unterstützten in einer Umfrage von Leewas für das Medienunternehmen Tamedia 47 Prozent das Vertragspaket («klar oder eher dafür»). 35 Prozent lehnten die Bilateralen III ab («eher oder klar dagegen»). 18 Prozent zeigten sich unentschieden.
Auffällig ist, dass von Januar bis März 2025 die Befürworter der Bilateralen III deutlich abgenommen haben, die Gegner und die Unentschiedenen klar zugenommen. Das kann an der unterschiedlichen Fragestellung der Umfragen liegen. Möglich ist aber auch, dass mit zunehmender Kenntnis des Vertragspakets die Skepsis diesem gegenüber zunimmt. Die Umfrage von gfs.bern vom Januar 2025 wurde nur einen Monat nach Abschluss der Verhandlungen durchgeführt, als noch relativ wenig über den Inhalt der Bilateralen III bekannt war. Interessant wird deshalb sein, wie Zustimmung und Ablehnung in zukünftigen Umfragen ausfallen werden. Dies, nachdem jetzt im Juni 2025 nach der Verabschiedung der Bilateralen III durch den Bundesrat noch einmal eine Welle der Information und Kommentierung in den Medien stattgefunden hat. Hervorzuheben ist, dass der Bundesrat seine abwartende Haltung inzwischen aufgegeben hat und Bundesrat Cassis wie auch die Bundesräte Jans und Rösti sich öffentlich klar für die Verträge ausgesprochen haben.
In der internen Debatte geht es realpolitisch vor allem um die eigenen wirtschaftlichen Interessen. Zu kurz kommt, dass die Verträge einen wesentlichen Beitrag an die Stabilisierung der europäischen Integration in schwierigen geopolitischen Zeiten leisten. Die EU ist aus diesem Grund der Schweiz in wesentlichen Punkten entgegengekommen. Das gilt namentlich für den Ausschluss der Landwirtschaft von Ausgleichsmassnahmen und von der dynamischen Rechtsübernahme. Die Bilateralen III ermöglichen es Dank der neuen Mitsprache der Schweiz, sich über die Schengener Abkommen hinaus aktiv an der Gesetzgebung in der EU zu beteiligen. Sie gewinnt so an Souveränität und leistet gleichzeitig ihren Beitrag an den Aufbau Europas. Die Verträge werden das Selbstbewusstsein und die Solidarität unseres Landes in Europa als unsere Heimat stärken.
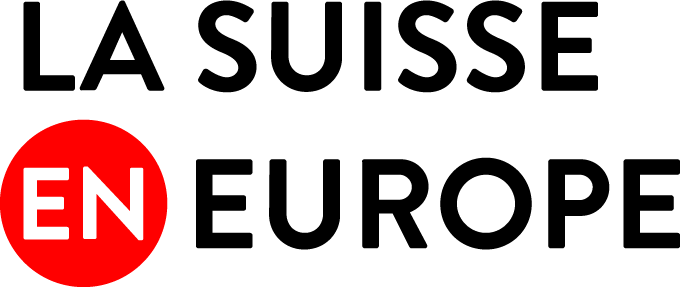
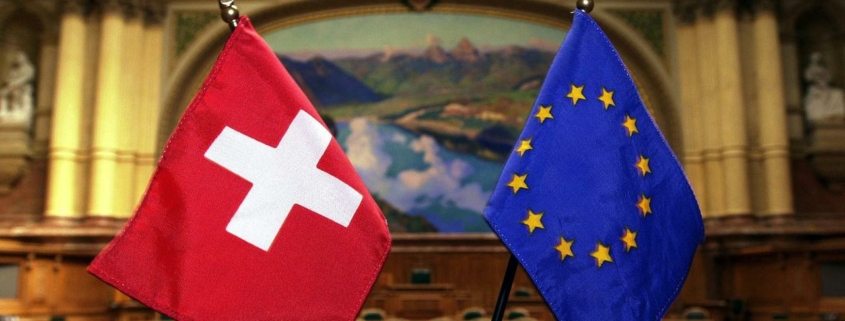

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !