Schweizerische Europapolitik: Hektische Stagnation von Daniel Woker
Im neuesten Bericht zu den Diplomatischen Dokumenten der Schweiz (Dodis), nach einer Sperrfrist von 30 Jahren freigegeben am 1. Januar 2024, wird das Jahr 1993 beleuchtet. Hauptthema war damals und bleibt heute das Verhältnis der Schweiz zur EU. Auch andere aussenpolitische Realitäten sind seither unverändert geblieben.
Seit der knappen, aber negativen Volksabstimmung über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) von 1992 ist das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU zerrüttet. Die danach abgeschlossenen bilateralen Abkommen I und II sind ein Heftpflaster, das der Schweiz einen Notzugang zum europäischen Binnenmarkt erlaubt. Die nie genesene Wunde muss nun neu durch die Bilateralen III verarztet werden. Es ist ein Lichtblick, dass die Weiterführung des Zugangs zum Binnenmarkt sowohl von Seiten der EU als auch der Schweiz positiv beurteilt wird. Gemäss einer kürzlich veröffentlichen Umfrage will eine klare Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer ein geordnetes Verhältnis mit der EU. Offen bleibt die Wunde, da in zahlreichen anderen gesamteuropäischen Belangen – Klimaschutz, Regelung von Zukunftstechnologien, Sicherheitspolitik insbesondere mit einem möglichen neuerlichen Präsidenten Donald Trump in Washington – die Schweiz nicht an Entscheidungsfindung und Beschlussfassung der EU beteiligt ist. Ihr bleibt nolens volens nur der Nachvollzug.
1993: Europäischer Optimismus trotz allem
Trotz dem deprimierenden Nein zum EWR Ende 1992 – am berühmte Dimanche Noir des damaligen Bundesrates Jean-Pascal Delamuraz – blieb die Landesregierung auch im unmittelbaren Nachgang dazu optimistisch, dass die folgende Epoche mit einem bilateralen Zugang zur damaligen EG (Europäische Gemeinschaft) ein kurzzeitiges Provisorium bleiben würde. Dies vor einem definitiven Entscheid, ob voller Beitritt zur EG oder doch ein zweiter Anlauf zum EWR. 1993 signalisierte der Bundesrat im aussenpolitischen Bericht, dass ein Beitritt «noch in diesem Jahrhundert» wahrscheinlich sei.
Das wurde damals auch an bilateralen Treffen mit den Chefs der wichtigsten Partnerländer so dargelegt. Das förderte deren Entgegenkommen, der Schweiz die Extrawurst eines vorläufigen bilateralen Zugangs zum europäischen Binnenmarkt zu erlauben. So wird der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl im Dodis-Bericht mit dem Zitat erwähnt «Schweizer Trotz hilft auf die Dauer nichts». Und auch der frühere französische Staatspräsident François Mitterrand liess sich überzeugen, dass die Schweiz in ihrem eigenen Interesse bald der EG beitreten würde, wie sich das für die übrigen europäischen Neutralen Österreich, Schweden und Finnland damals abzeichnete.
Auf konservativen Nationalismus eingeschwenkt
Wie man nun weiss, trat dies leider nicht ein. Vielmehr folgten 30 Jahre hektischer Stagnation in der schweizerischen Europapolitik. Diese kaprizierte sich primär darauf, möglichst viele bilaterale Vorteile zu erreichen, ohne bleibende Verpflichtungen übernehmen zu müssen. Auch wenn 2024 mit den Bilateralen III eine weitere provisorische Lösung gefunden werden sollte, ist emotionslos festzustellen, dass die Schweiz in den vergangenen 30 Jahren im Verhältnis zur EU auf einen Kurs des konservativem Nationalismus eingeschwenkt ist.
Der von Blochers SVP 1992 mit ihrer Schmutzpropaganda gegen Europa – «Brüssel als moderner Habsburger Drache, der die wehrhafte Schweiz verschlingen will» – eingeleitete Prozess hatte ungeahnten Erfolg über weite Teile der politischen Schweiz hinweg. Er führte zu einem generellen Rechtsruck auch links von der Schweizerischen Volkspartei. Hatte die FDP Anfang der 90er-Jahre den EG-Beitritt noch in ihrem Parteiprogramm, so meinte der Präsident der Jungen (!) FDP in einer öffentlichen Diskussion kürzlich im Brustton der Überzeugung eines Zürcher Bahnhofstrasse-Liberalen «Beitritt der Schweiz zur EU: nie».
Kein europäisches Bewusstsein vorhanden
Dies ist umso kurzsichtiger, als spätestens seit dem kürzlichen Entscheid der EU mit Kiew Beitrittsverhandlungen aufzunehmen, die Ukraine ein unverzichtbarer Teil von Europa geworden ist. Die schweizerische Ukrainepolitik ist also damit ebenfalls Teil unserer Europapolitik. Auch hier ist heutzutage nichts von einem europäischen Bewusstsein der Schweiz auszumachen. Es herrscht primär Verweigerung: keine Waffenlieferungen wegen dem Neutralitätsdogma, keine Finanzhilfe wegen der Schuldenbremse und der konservativen Nationalbank und auch keine schweizerische Friedensvermittlung, die offensichtlich nicht gefragt ist. Der Lichtblick besteht hier in der Absicht des Auswärtigen Departements, über zehn Jahre sechs Milliarden Franken Wiederaufbauhilfe zu leisten. Aber auch diese Geste ist mit Schatten behaftet, sollte diese Summe zulasten der Unterstützung des globalen Südens gehen.
Europäisches Bewusstsein wäre hier einmal angezeigt, weil auch uns wohl geneigte internationale Beobachter der schweizerischen Ukrainepolitik mit Unverständnis und Kritik begegnen. So etwa der ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck, das verkörperte Gewissen Deutschlands, in einem Jahreswechsel-Gespräch in den Tamedia-Zeitungen. Er sieht mehr Solidarität mit der von Wladimir Putins Aggression schwer geprüften Ukraine als Jahrhundertaufgabe Europas an.
Sicherheitspolitik: Mehr Nato und EU notwendig
Aber auch im ureigenen Interesse unseres Landes sind grössere europäische Anstrengungen der Schweiz dringend nötig. So beispielsweise in der Sicherheitspolitik. Wie von Verteidigungsministerin Viola Amherd eben betont – und vom neu ernannten Staatssekretär im VBS, Brigadier Markus Mäder nachdrücklich unterstrichen –, wird die massive Erhöhung des schweizerischen Wehrbudgets, um sinnvoll zu sein, auch engere und mehr Zusammenarbeit mit der Nato und der sicherheitspolitischen EU mit sich bringen. Um in beiden Organisationen ernst genommen zu werden, muss die Jungfrau Helvetia von der unbefleckten (Neutralitäts-)Empfängnis abrücken und schönen Worten Taten zu Gunsten der Ukraine folgen lassen, dem gegenwärtig dringendsten Brennpunkt von Nato und EU.
Auch hier kontrastiert die ergebnisorientierte, offene Politik von Anfang der 1990er-Jahre mit der gegenwärtigen Neutralitätsängstlichkeit. Wie im Dodis- Bericht nachzulesen ist, erlaubte der Bundesrat damals im Rahmen der primär serbischen Aggression in Bosnien-Herzegowina ein erstes Mal militärische Überflüge der Nato über die Schweiz – «neutrality be damned».
Gute Dienste trotz Neutralität nicht gefragt
Neutralitäts-Fetischisten verweisen gerne auf die angeblich nur wegen der Neutralität möglichen Guten Dienste der Schweiz, im Sinne einer geschichtlichen, unverrückbaren Realität. Die Dodis-Dokumente von 1993 gehen auch auf die damalige Nahostpolitik des Bundesrates ein, mit Berichten über Kontakte mit Israel ebenso wie mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO); dies aber immer im Rahmen der damals dominanten Verträge von Oslo. Die wichtigsten im Spannungsfeld Nahost je geführten Verhandlungen fanden unter der Ägide der USA in der Hauptstadt des Nato-Mitglieds Norwegen statt und nicht im internationalen Begegnungsort Genf in der neutralen Schweiz.
Dies entspricht einem im Dodis-Bericht erwähnten Résumé des damals als schweizerischer Botschafter in Washington abtretenden Edouard Brunner, der ausdrücklich festhielt, dass die USA seit Ende des Kalten Krieges ihr Interesse an der schweizerischen Neutralität verloren hätten.
Heute steht mit Blick auf den Nahen Osten mit der Aktualität des Krieges zwischen der palästinensischen Terrororganisation Hamas und Israel das Mittun der Schweiz im Uno-Sicherheitsrat im Mittelpunkt. Die Schweiz hat sich in New York im Rahmen ihrer Möglichkeiten bislang gut geschlagen. Positiv ist insbesondere, dass sich so die aussenpolitische Diskussion in der Schweiz – und damit ein entsprechendes Bewusstsein hierzulande – verstärkt hat. Das Bewusstsein nämlich, was ein mittelgrosser europäischer Staat angesichts zunehmender Schwerpunktverlagerung von Europa weg auf der globalen Bühne ausrichten kann und – vor allem – was nicht. Insbesondere, wenn ihm das spezifisch schweizerische Handicap anhaftet, nicht an den zwei Strukturen EU und Nato teilzuhaben, die global für ein starkes Europa stehen.
Im Nahen Osten wird weiterhin eine schweizerische Vermittlung von den Konfliktparteien offenbar nicht nachgefragt. Das lässt deren konstantes Anbieten eigenartig erscheinen. Genf und das Weltwirtschaftsforum in Davos sind internationale Treffpunkte, welche mit spezifisch schweizerischer Leistung nur mehr wenig zu tun haben.
Wenn Innenpolitik die Aussenpolitik dominiert
Schliesslich werfen auch institutionelle Probleme Schatten auf die schweizerische Aussenpolitik. Entgegen einem oft gehörten Bonmot ist nicht alle Aussenpolitik auch Innenpolitik, sondern gerade umgekehrt: Dominiert die Innenpolitik die Aussenpolitik, wird letztere zur Mühsal und Peinlichkeit. Beispielhaft steht dafür etwa die kleinliche innerschweizerische Diskussion über die Spesenentschädigung für entsandte ausländische Arbeitnehmer zu einem Zeitpunkt, wo in Brüssel um Unterstützung für die Ukraine und damit um die Antwort auf die Schicksalsfrage nach der Zukunft der Demokratie in Europa gerungen wird.
Dem dabei aktiv als europäische Abrissbirne tätigen und dem russischen Autokraten und Kriegsherrn Wladimir Putin zudienenden ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban haben rechtskonservative Kreise, angeführt von Blochers SVP, kürzlich in Zürich zugejubelt. Ausgerechnet die zwei Vertreter dieser Partei im Bundesrat – Guy Parmelin und Albert Rösti – sind mit zentralen Dossiers in den bilateralen Verhandlungen Berns mit Brüssel betraut. Werden Sie über den Schatten ihrer Parteidoktrin, die grundsätzlich zu allem, was mit der EU zu tun hat, nein sagt, springen wollen, springen können?
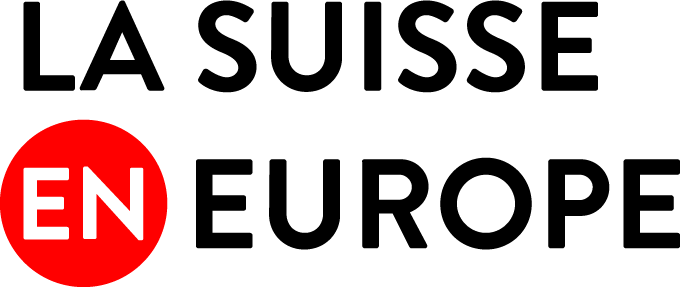



Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !