Der bilaterale Weg hat seine Grenzen von Martin Gollmer
Vor 25 Jahren, am 21. Juni 1999, unterzeichneten die Schweiz und die EU ein erstes Paket bilateraler Verträge, die sogenannten Bilateralen I. 2004 folgte ein zweites Paket, die Bilateralen II. Gegenwärtig verhandeln Bern und Brüssel über ein weiteres Paket, die Bilateralen III. Mit ihm soll der zwischenzeitlich holperig gewordene bilaterale Weg stabilisiert und weiterentwickelt werden. Aus Anlass des Jubiläums fragen wir: Ist der Bilateralismus mit der EU der Königsweg für die Schweiz oder eine Sackgasse?
Die Schweiz ist mit der EU aufs Engste verbunden: geografisch, wertemässig, kulturell, wirtschaftlich und menschlich. Trotzdem ist die Schweiz nicht Mitglied der EU. Sie regelt ihre Beziehung zu dieser stattdessen mit bilateralen Verträgen. Aktuell sind es über 120. Die wichtigsten sind das Freihandelsabkommen von 1972, das Versicherungsabkommen von 1989, das bilaterale Vertragspaket I von 1999 und das bilaterale Vertragspaket II von 2004.
Die Bilateralen I sichern der Schweiz mittels des Personenfreizügigkeitsabkommens und des Abkommens über die technischen Handelshemmnisse einen hindernisfreien teilweisen Zugang zum EU-Binnenmarkt, dem Herzstück der Europäischen Union. Die Bilateralen II erlauben der Schweiz über das Dublin-Assoziationsabkommen die Teilnahme an der EU-Asyl- und Migrationspolitik. Und über das Schengen-Assoziierungsabkommen ermöglichen sie den Schweizerinnen und Schweizern das Reisen ohne Grenzkontrollen in weiten Teilen Europas.
Die Schweiz profitiert
Diese für einen Nicht-Mitgliedstaat einzigartige, nicht selbstverständliche partielle Integration in die EU und ihren Binnenmarkt nützt der Schweiz enorm. Gemäss einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2019 steht sie nämlich unter den EU- und EFTA-Mitgliedstaaten mit 2914 Euro pro Einwohner an Einkommensgewinnen an der Spitze, gefolgt von Luxemburg (2834 Euro) und Irland (1894 Euro). In Deutschland betragen die Einkommensgewinne pro Kopf 1046 Euro, in Österreich 1583 Euro. Diese Ergebnisse zeigen gemäss Studie, «dass kleine, offene Volkswirtschaften mit starker Handelsorientierung und hoher Wettbewerbsfähigkeit vom EU-Binnenmarkt besonders profitieren». Diese Volkswirtschaften liegen zudem meistens nahe dem geografischen Zentrum Europas.
Aufgrund dieser rein wirtschaftlichen Sichtweise entpuppt sich der Bilateralismus mit der EU tatsächlich als Königsweg für die Schweiz: Sie kann von der EU profitieren, ohne ihr beitreten zu müssen. Doch der Bilateralismus stagniert seit Jahren; seit 2004 wurden keine wichtigen neue Abkommen mehr mit der EU abgeschlossen. Als dann die Schweiz 2021 jahrelange, zähe Verhandlungen mit der EU über ein die bilateralen Verträge ergänzendes institutionelles Rahmenabkommen einseitig abbrach, schien der bilaterale Weg sogar abrupt an seinem Ende angekommen zu sein. Als Reaktion weigerte sich die EU nämlich, neue Abkommen mit der Schweiz abzuschliessen. Und die bestehenden Verträge drohten langsam zu erodieren, weil die EU sie nicht mehr erneuern wollte.
In der Not erfand der Bundesrat einen neuen Verhandlungsansatz: Die für die Schweiz schwierigen institutionellen Fragen sollten zusammen mit neuen bilateralen Abkommen in den Bereichen Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit in einem neuen weiteren Paket geregelt werden – den Bilateralen III. Ebenfalls angestrebt wird im Rahmen dieses Pakets eine Wiederaufnahme in die Bildungs- und Forschungsprogramme der EU, aus denen die Schweiz nach dem Verhandlungsabbruch ausgeschlossen worden war. Das alles sollte einen besseren Interessenausgleich zwischen der Schweiz und der EU zulassen. Darüber verhandeln jetzt Bern und Brüssel nach vorangehenden, länglichen Sondierungsgesprächen seit vergangenem März. Ziel des Bundesrats ist es, den bilateralen Weg zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.
Unmut macht sich breit
Wie auch immer diese Verhandlungen ausgehen und unabhängig davon, ob das Verhandlungsergebnis dereinst vor dem Parlament und dem Volk Gnade findet, das Paket könnte das letzte sein, auf das die EU einzutreten bereit ist. Denn vor allem in mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten macht sich zunehmend Unverständnis, ja Unmut über den schweizerischen Sonderweg breit. Warum soll das reiche Nichtmitglied Schweiz Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten und obendrein erst noch Ausnahmen aushandeln können, wird gefragt. Denn diese wirtschaftlich noch nicht so weit wie die Schweiz entwickelten Mitgliedstaaten mussten sich bei ihrem EU-Beitritt im Jahr 2004 den Zugang zum Binnenmarkt weitestgehend ohne Ausnahmen erkaufen.
Irgendwann dürften diese Mitgliedstaaten deshalb genug haben von schweizerischen Rosinenpicken. Der bilaterale Weg dürfte darum nicht unendlich ausbaubar sein. Er könnte mittel- bis langfristig zu einer Sackgasse werden.
Kommt noch ein weiterer Nachteil des bilateralen Wegs dazu: Er liefert keine Antworten auf die aussen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen, die die Schweiz spätestens seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Verhältnis zur EU umtreiben. In der Klimapolitik drängt sich ebenfalls eine Zusammenarbeit der Schweiz mit der EU auf. Aber auch hier greift der bilaterale Ansatz zu kurz. Dieser hat im Wesentlichen eine wirtschaftliche Ausrichtung. Das ist zu wenig angesichts der Problemvielfalt, der sich die Schweiz im europäischen Kontext gegenübersieht.
Der Bilateralismus mit der EU hat also seine Grenzen. Es wäre deshalb an der Zeit, dass sich die Schweiz weitergehende Alternativen zu überlegen beginnt – etwa einen zweiten Anlauf zu einem Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder gar einen EU-Beitritt. Oder dann sollten die bilateralen Verträge mit der EU wenigstens – und wenn möglich – mit einem sicherheits- und verteidigungspolitischen Volet und einem Klimaabkommen ergänzt werden.
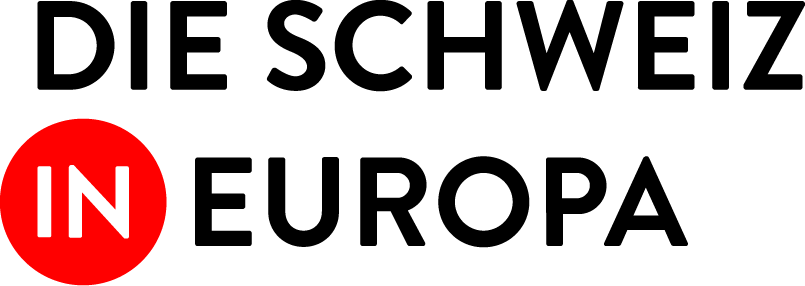



Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!