Thomas Cottier: Das missverstandene Streitbeilegungsverfahren im Rahmenabkommen mit der EU
Jahrzehntelang hat sich die EU geweigert, die Beziehungen zur Schweiz einem allgemeinen gerichtlichen Streitbeilegungsverfahren zu unterstellen. Nun ist sie bereit, und es ist offensichtlich, dass die Schweiz mit diesem Verfahren nur gewinnen kann.
Das Streitbeilegungsverfahren des Rahmenabkommens sei toxisch, die Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) inakzeptabel und nicht mehrheitsfähig. Sie mache das vorgesehene Schiedsgericht zur Farce und verletze die Souveränität. So lautet die Parole der Gegner des institutionellen Rahmenabkommens. Lieber fahre man mit dem Status quo weiter. Diese Einwände sind nicht stichhaltig. Die Debatte ist durch Vorurteile und Missverständnisse geprägt: Vorab ist zwischen Verfahren vor nationalen Gerichten in der Schweiz und den Mitgliedstaaten und dem neuen und umstrittenen Schiedsverfahren des Rahmenabkommens zu unterscheiden.
Von der politischen Bühne zum Rechtsweg
Die allermeisten gerichtlichen Verfahren zur Anwendung und Auslegung der bilateralen Verträge werden sich wie heute weiterhin vor nationalen Gerichten abspielen. Die Schweiz und die EU kennen die unmittelbare Anwendung dieser Verträge. Sie sind Teil des Landesrechts und gehen davon abweichenden Gesetzen, Verordnungen und Praktiken vor. Auf die Abkommen gestützte Klagen werden vor erst- und zweitinstanzlichen kantonalen Gerichten sowie vor den Gerichten des Bundes geführt und entschieden, in letzter Instanz durch das Bundesgericht. Dieses entscheidet abschliessend. Ebenso führen Klagen aufgrund der bilateralen Verträge in den Mitgliedstaaten über deren Gerichte. Sie unterliegen dem Vorabentscheidungsverfahren des EuGH.
Die nationalen Gerichte können Auslegungsfragen vorlegen. Die Höchstgerichte müssen vorlegen, soweit die Rechtslage nicht bereits hinreichend geklärt ist («actes claires»). Für die Mitgliedstaaten – nicht aber die Schweiz – ist das Urteil des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren massgebend. Das Bundesgericht wird solche Urteile im Dialog mit dem EuGH wie bereits heute berücksichtigen, ist aber als Präjudiz nicht daran gebunden.
Neu im Rahmenabkommen ist, dass Streitigkeiten der politischen Bühne auf dem Rechtsweg entschieden werden können. Heute liegen sie mit Ausnahme des Versicherungsabkommens allein in den Händen der Gemischten Ausschüsse und der politischen Behörden. Kann keine Lösung gefunden werden, drohen politisch motivierte Massnahmen (Stichwort Börsenäquivalenz). Anders als heute kann mit dem Rahmenabkommen jede Partei eine Streitfrage einem Schiedsgericht aus drei Personen – aus der Schweiz, der EU und einem Drittstaat – vorlegen. Das wird selten, wenn überhaupt jemals vorkommen. Denn die Möglichkeit eines Schiedsverfahrens dürfte die politische Einigung begünstigen.
Kommt es aber zur Klage der Schweiz oder der EU, so urteilt das eingesetzte Schiedsgericht über Anstände aus dem Rahmenabkommen und den bilateralen Verträgen. Gegenstand des Verfahrens kann die angebliche Unvereinbarkeit des inländischen Rechts mit den Verträgen sein. Dazu gehören auch Urteile von Gerichten, die völkerrechtlich Teil des Landesrechts sind und ebenfalls dem Grundsatz «pacta sunt servanda» unterliegen. Das Schiedsgericht ist dabei verpflichtet, Fragen des EU-Rechts dem EuGH vorzulegen. Es handelt sich dabei vor allem um offene Fragen bei der Auslegung von Richtlinien und Verordnungen, welche die Schweiz vor dem Hintergrund der dem Rahmenabkommen unterstellten Verträge übernommen hat. Die Vorlage dient dem Zweck, eine allgemeingültige Auslegung für den gesamten Binnenmarkt gerichtlich festzulegen. Der EuGH wird diese mit Blick auf alle Mitgliedstaaten und den gesamten Binnenmarkt, und nicht allein im Verhältnis zur Schweiz vornehmen.
Selbständige Rolle des Schiedsgerichts
Der Vorwurf der Parteilichkeit ist daher unbegründet. Absehen kann das Schiedsgericht von einer Vorlage, wenn die Rechtslage bereits durch frühere Urteile geklärt wurde («actes claires»). Zentral ist, dass sich die Zuständigkeit nur auf übernommene Normen und Begriffe des EU-Rechts bezieht, nicht aber auf die bilateralen Verträge an sich, die zum Völkerrecht gehören und ihren eigenen Normen folgen. So ist zum Beispiel der Begriff der Diskriminierung in Art. 2 des Freizügigkeitsabkommens nicht identisch mit der Diskriminierung im EU-Vertrag, so wie sie sich auch von entsprechenden Grundsätzen in der WTO unterscheidet. Das Schiedsgericht wird über Abgrenzungsfragen selbständig entscheiden. Es spielt also eine durchaus eigenständige Rolle und ist für die Auslegung der bilateralen Verträge zuständig.
Die Schweiz ist nicht verpflichtet, ein Urteil des Schiedsgerichts umzusetzen, wo am eigenen Recht festgehalten werden soll und eine Völkerrechtsverletzung politisch in Kauf genommen wird. Die EU kann dann Ausgleichsmassnahmen treffen. Das gleiche Recht gilt auch für die Schweiz. Von zentraler Bedeutung und neu ist, dass solche Massnahmen der erneuten Beurteilung des Schiedsgerichts unterliegen. Dieses prüft abschliessend, ob die Ausgleichsmassnahmen dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen. Es ist offensichtlich, dass die Schweiz mit diesem Verfahren nur gewinnen kann. Jahrzehntelang hat sich die EU politisch geweigert, die Beziehungen zur Schweiz einem allgemeinen gerichtlichen Streitbeilegungsverfahren zu unterstellen. Das Freihandelsabkommen von 1972 kennt sie immer noch nicht (Stichwort Unternehmenssteuern). Heute, wo die Union mit dem Rahmenabkommen dazu bereit ist, schiesst sich die Politik in der Schweiz aus Unkenntnis der Rechtslage mit unsachlichen und falschen Behauptungen erneut ins eigene Bein.
Dieser Beitrag von ASE-Präsident Thomas Cottier erschien am 25. Februar als Gastkommentar in der NZZ.
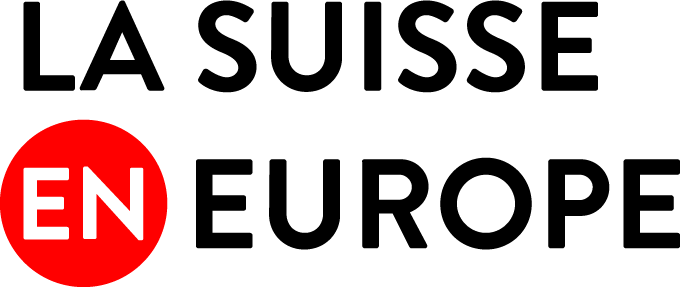



Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !