Der Beteiligungsvertrag von Daniel Woker
Das Verhandlungspaket Bilaterale III gibt der Schweiz permanenten Zugang zum europäischen Binnenmarkt und darüber hinaus.
Europafeinde und MSGA-Nachäffer (MSGA = Make Switzerland Great Again) in der Schweiz schimpfen die Bilateralen III einen «Unterwerfungsvertrag». Wie dies bei US-Präsident Donald Trump die Regel ist, trifft auch hier genau das Gegenteil zu: Mit den Bilateralen III schlagen wir eine solide und zukunftstaugliche Brücke zur Europäischen Union (EU). Die Schweiz kann sich sektoriell am grossen EU-Binnenmarkt und fallweise an wichtigen EU-Programmen etwa zu Forschung und Bildung beteiligen. Die Bilateralen III sind daher ein «Beteiligungsvertrag». Von diesem profitiert die schweizerische Wirtschaft, aber auch jede Schweizerin und jeder Schweizer.
Keuchhusten und Affenpocken sind Seuchen, welche Europa, damit auch die Schweiz, in den vergangenen Jahren betroffen haben. Der Impfstoff dagegen wird exklusiv von einer kleineren Firma in Dänemark hergestellt. Diese war mit der Produktion für den EU-Markt voll ausgelastet. Darum und weil die Schweiz andere Zulassungsregeln für Pharmaprodukte hat als die EU wurden schweizerische Ersuchen für den Kauf dieses Impfstoffs abschlägig beantwortet.
Dies ist lediglich ein krasses Beispiel, warum der Markt Schweiz ganz einfach zu klein ist, um im Kalkül ausländischer Produzenten von Produkten, welche in der Schweiz nicht hergestellt werden, zu zählen. Anders nur, wenn wir uns am EU-Binnenmarkt beteiligen – bei Impfstoffen aber auch in vielen anderen Bereichen.
Donald Trumps Erpesserzölle
Noch wissen wir nicht, was die Schweiz. in ihren Verhandlungen mit der Trump-Regierung herausholen kann, um den amerikanischen Erpresser-Zoll von 31 Prozent abzuwenden. Wohl kaum aber einen besseren Deal als die EU, welche seit ihrem letzten Gipfel die Tonart gegenüber Washington verschärft hat und mit für die USA und speziell Trump-Wähler schmerzlichen Retorsionsmassnahmen droht. Ausschlaggebend für gute Verhandlungsergebnisse in Washington ist nicht ein angeblich spezielles Verhältnis der Schweiz zu den USA, sondern schiere Marktmacht.
Auch wenn die von Trumps MAGA-Politik unmittelbar bedrohte schweizerische Pharmaindustrie dank grossen Investitionen in den USA eine Spezialbehandlung für ihre Produkte erhält, so wird das sicher nicht für ebenso wichtige Branchen zutreffen wie die schweizerische Maschinen- und die Uhrenindustrie. Auch hier gilt der simple arithmetische Grundsatz, dass letztlich allein Marktgrösse bestimmend ist.
Die Bilateralen III schaffen also die Grundlage für die Behauptung der Schweiz auf den Weltmärkten. Bilaterale Freihandelsabkommen (FTA), wie das eben unter helvetischen Fanfarenstössen vereinbarte FTA mit den Mercosur-Staaten in Südamerika sind gut, aber mit ihrem vergleichsweise geringen Umfang von betroffenen Güter keinerlei Ersatz für unsere Hauptexporte in die EU-Länder und in die USA.
WTO-Ersatz CPTPP
Hinter diesem Buchstabensalat verbirgt sich eine grosse Möglichkeit von Welthandel mit klaren Regeln, aber ohne die Teilnahme der USA, welche unter Trump bekanntlich das Funktionieren der Welthandelsorganisation WTO blockiert.
CPTPP steht für Comprehensive Progressive Trans Pacific Partnership, ein multilateraler Freihandelsvertrag, der im Grossraum Indo-Pazifik wichtige Wirtschaftsmächte umfasst. Die USA haben sich unter Trump davon zurückgezogen, China und Indien sind (noch?) nicht Mitglieder. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat kürzlich vorgeschlagen, dass die EU mit diesem Verbund Verhandlungen über einen Beitritt führen soll. Das würde der CPTPP auf einen Schlag weltweite Bedeutung verleihen. Und damit einen wichtigen Schritt zum Erhalt global gültiger Handelsregeln darstellen.
Laut Quellen aus der Bundesverwaltung hat die Schweiz, üblicherweise im Rahmen der EFTA, also namentlich mit Norwegen zusammen, noch keine Anstalten getroffen zur Teilnahme an der CPTPP. Das wäre nun ein überfälliger Schritt für die Schweiz, welche als Exportnation auf klare Regeln im Welthandel dringend angewiesen ist. Auch hier erscheint eine Koordination mit der EU dringlich, was die Bedeutung der Bilateralen III als Brücke zur EU und als Beteiligungsvertrag an wichtigen Entwicklungen am Welthandel unterstreicht.
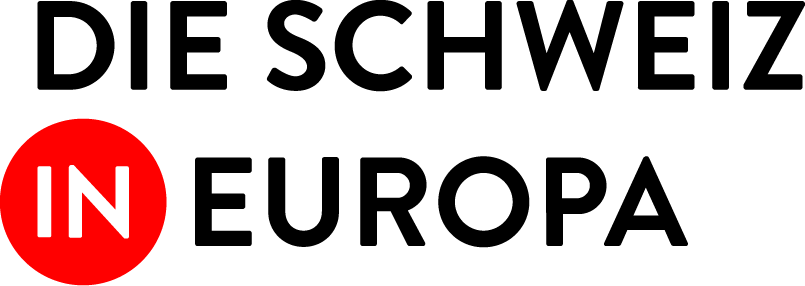





 Keystone/Arno Balzarini
Keystone/Arno Balzarini