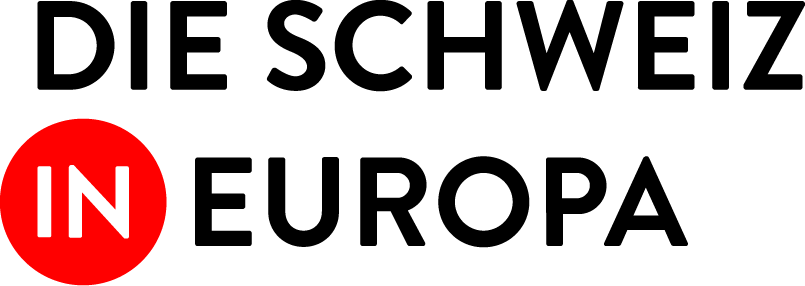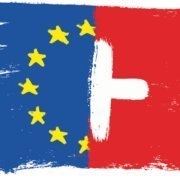Um die Diskussion um das Rahmenabkommen auf eine neue Ebene zu heben, arbeitet die ASE in drei Arbeitsgruppen die Bedeutung eines Rahmen-Vertragsabschlusses für ausgewählte Bereiche heraus.
Die drei Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit der Digitalisierung, Energie- und Klimafragen sowie dem Dreieck Migration, Handel und Investitionen. Die folgenden Abstracts bilden die Grundlage für die Arbeit. Wenn Sie an einer Mitarbeit in der einen oder anderen Arbeitsgruppe interessiert sind, können Sie sich gerne via contact@suisse-en-europe.ch unter Angabe Ihrer gewünschten Arbeitsgruppe melden.
groupe de travail: numérisastion
L’UE établit actuellement un marché unique numérique afin d’améliorer l’accès aux biens et services digitaux, créer un environnement propice au développement de réseaux et de services digitaux et utiliser la numérisation comme moteur de croissance. Le futur numéraire de l’Europe devra incorporer des technologies utilisables pour tous, une économie équitable et compétitive et une société démocratique, ouverte et durable.
Le programme de l’UE comprend un grand nombre d’actes – Règlements, Directives, Communications, Décisions, Initiatives, Plans d’actions et Partenariats – sur lesquels la Suisse a pris position en identifiant d’éventuels besoins d’action ou de coopération[1]. La Suisse participe activement à de nombreux groupes d’experts de l’UE et aux principaux projets européens ayant trait à la numérisation[2].
Le programme pour une Europe numérique[3] complète et accompagne un certain nombre d’autres instruments proposés dans le cadre financier pluriannuel pour l’après 2020, notamment : Horizon Europe, mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), programme Europe créative (y compris Media), Erasmus, Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (compétences numériques de base et avancées), Environnement et action pour le climat (y compris efficacité énergétique).
Le budget de l’UE prévoit d’attribuer des fonds importants à cinq domaines : calcul haute performance (2.2 milliards euros), intelligence artificielle (2.1 mrds euros), cybersécurité et confiance (1.6 mrds euros), compétences numériques avancées (577 millions euros) et déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité (1.1 mrd euros). Les membres de l’EEE, les pays disposant d’un accord-cadre et les pays tiers pourront participer au programme selon des modalités propres à leur relation avec l’UE.
Actuellement s’ajoutent, sur le plan législatif, les propositions pour une directive sur les mesures pour un haut niveau de cybersécurité, pour la régulation numérique au travers du règlement sur les services numériques (Digital Services Act) et du règlement sur les marchés numériques (Digital Market Act) pour les firmes ayant un impact (GAFA[4] notamment). Ces propositions devront être analysées afin d’évaluer l’intérêt de la Suisse et de l’UE à des formes de coopération, le cas échéant par le biais de déclarations ou d’arrangements spécifiques.
[1] La Suisse et le marché unique numérique de l’Union européenne, DETEC, DFAE, DFF et DEFR, 18.06.19 CH. Suisse et le marché numérique UE, 14.06.19.pdf
[2] Stratégie de l’Union Européenne pour un marché unique numérique. Conséquences pour la Suisse. Rapport en réponse au Postulat Vonlanthen 16.3080 du 15.03.16, SECO, 07.12.18.
[3] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-27, Bruxelles, 06.06.18, COM 434 final. Source
[4] Géants de l’internet : Google, Apple, Facebook, Amazon.
groupe de travail: ressources naturelles, énergie, climat et environnement
Le « European Green Deal » proposé par la Commission le 11.12.2019 représente un plan d’action inclusif et systématique couvrant tous les secteurs économiques. L’objectif d’atteindre une économie neutre en carbone en 2050 est en ligne avec la trajectoire du CF pour 2050. Le Green Deal précise que « son ambition ne pourra pas être atteinte exclusivement par l’UE et que l’UE pourra utiliser son influence, son expertise et ses ressources financières pour mobiliser ses voisins et partenaires… ». Les composants relatifs à l’énergie, au transport, à la construction et à la décarbonisation de l’économie ont une importance particulière pour la Suisse.
Dans le domaine des ressources naturelles, le Green Deal est développé notamment par la stratégie « Farm to Fork » (F2F). Celle-ci doit influencer la nouvelle politique agricole commune (PAC), dans laquelle les dispositions environnementales sont fortement renforcées (écorégimes obligatoires, conditionnalité renforcée…). F2F constitue une sorte de « benchmark » qui peut être aussi une référence pour la Suisse, de manière générale et sur des points spécifiques qui ont des implications « transfrontalières ». Exemples : la réduction des pesticides (-50% d’ici 2030, à comparer avec les initiatives populaires) et des antibiotiques (-50 %), ou l’objectif de 25% des terres agricoles en biologique. Le Conseil des Etats ayant refusé en décembre 2020 le projet de Politique agricole 2022-2025 (PA «2022+), celui-ci devra être revu par le Conseil fédéral et la comparaison avec F2F et la nouvelle PAC sera pertinente.
De manière plus immédiate, F2F stipule que l’objectif de durabilité devra être pris en compte dans tous les accords bilatéraux de l’UE. L’harmonisation entre les clauses environnementales de l’UE et de la Suisse (ex : accord avec l’Indonésie) renforcerait leur acceptabilité et leur impact. Les implications d’une éventuelle taxe carbone sur les importations doivent aussi être analysées. Plus généralement, F2F promeut une action internationale, qui concerne aussi la Suisse, dans le domaine de la normalisation (Codex), de l’étiquetage, et des activités internationales globales (ex : Sommet des NU sur le Système alimentaire mondial de 2021).
Le Green Deal prévoit de proposer en mars 2020 une stratégie de biodiversité, incluant explicitement la coopération transfrontalière et tenant compte du réseau Natura 2000. Cela a clairement une implication pour la Suisse, tout comme la nouvelle stratégie forestière.
Arbeitsgruppe Migration, Handel und Investitionen
Das Freizügigkeitsabkommen und das Schengener Abkommen integrieren die Schweiz migrationsrechtlich weitgehend in den Binnenmarkt. Das bezieht sich indessen nur auf Angehörige der Mitgliedstaaten und Reisende. Die Zusammenarbeit im Asylbereich und der Arbeitsmigration bleibt indessen ad hoc punktuell; die Schweiz hat keinen Einfluss auf die Gestaltung der Asylpolitik in der EU und der Lösung deren Probleme. In der Frage der Rückübernahmen gibt es nur ansatzweise eine Koordination. Kaum nennenswerte Koordination gibt es in Bezug auf wirtschaftliche Abkommen, welche vor Ort Chancen und Arbeitsplätze für junge Menschen schaffen könnte, gerade auch in der Landwirtschaft, deren Exportmöglichkeiten die schweizerische Landwirtschaftspolitik wesentlich erschwert. Die Arbeitsgruppe nimmt sich dem Dreieck von Migration, Handel und Investitionen an und prüft Möglichkeiten einer stärkeren Zusammenarbeit und Koordination mit der Europäischen Union. Als Grundlage dienen u.a. das Paper von Thomas Cottier und Anirudh Shingal, Migration, Trade and Investment: Towards a New Common Concern of Humankind, 55 Journal of World Trade 51-76 (2021) und die 2020 abgeschlossene Dissertation von Rosa Losada, Transnationaler Migrationsdialog und Migrationspartnerschaften in der Schweiz: Historische Entwicklung, Bestand und Reformbedarf.