Auf in die Koalition der Willigen! von Daniel Woker
Angesichts von Putin und Trump ist eine Änderung unserer Aussenpolitik geboten. Allein im Einklang mit Europa kann sich die Schweiz behaupten.
Anstatt im Zollstreit mit den USA allein auf eine Sonderbehandlung durch Washington zu setzen, sollte die Schweiz eine selbstbewusste Politik betreiben, auch auf der Basis von eigener Macht. Denn allein dies und nicht vorauseilender Gehorsam ist es, was US-Präsident Donald Trump respektiert.
Genug Macht, um dem amerikanischen Frontalangriff gegen die bisherige westliche Ordnung zu begegnen, hat aber allein Europa als Ganzes. Die EU macht das richtig, sie verhandelt mit Trump über Zölle, ohne zu verhehlen, dass sie auch anders kann, beispielsweise mit Massnahmen gegen US-Dienstleistungsexporte. Die europäischen Nato-Staaten machen das richtig, indem sie bereit sind, Russland mit eigenen Mitteln und ohne aktive Teilnahme der USA die Stirn zu bieten.
Der grösste Feind von Politik und Wirtschaft ist Verunsicherung. Angesichts der globalen Unordnung ist momentan unklar, wie die Schweiz sich besser schützen kann. Und Schweizer Wirtschaftsakteure wissen nicht mehr, wie und wo sie zukünftig investieren und produzieren sollen.
Vorreiterrolle einnehmen
Die Diskussion über die schweizerische Teilnahme im EU-Binnenmarkt hat sich bislang in endlosen Kleinigkeiten verheddert. Einzelne Nato-Staaten haben wir durch Vorbehalte zur Verwendung von schweizerischem Kriegsmaterial gegen den russischen Angriff auf die Ukraine verärgert. Die vom Ständerat kürzlich verabschiedete Liberalisierung von Kriegsmaterialexporten ist ein erster, zaghafter Schritt, dem aber weitere folgen müssen, um im In- und Ausland sichtbar zu machen, dass die Schweiz zu Europa gehört. Und damit die europäischen Sorgen angesichts von Wladimir Putins Aggressionen – ganz zu schweigen von russischen Kriegsverbrechen – teilt und, wie die EU, dem trumpschen Handelskrieg nicht tatenlos zusehen will. Als Sitzstaat der Welthandelsorganisation WTO und traditioneller Champion des Freihandels muss die Schweiz da eine Vorreiterrolle einnehmen. Das mit der EU fertig ausgehandelte Verhandlungspaket der Bilateralen III liegt vor. Darüber kann – wenn wir das nur politisch wollen – möglichst rasch und noch vor den nächsten nationalen Wahlen abgestimmt werden. Ausser bei der nationalistischen Rechten herrscht Einigkeit, dass diese Vorlage dem Souverän mit guter Aussicht auf Annahme vorgelegt werden kann.
Gegen die Isolation
Die von Grossbritannien und Frankreich angestossene «Koalition der Willigen» ist eine von mehreren Anstrengungen der Länder Europas, einem Ausverkauf der Ukraine durch die USA Massnahmen entgegenzusetzen und auf mittlere Sicht eine eigenständige europäische Sicherheitspolitik zu entwickeln. In dieser Koalition machen auch die Neutralen Österreich und Irland mit, ebenso die Nicht-EU-Mitglieder Grossbritannien, Norwegen und sogar Island. Mitmachen bedeutet nicht, direkt Waffen an die Ukraine zu liefern oder der Nato beizutreten. Es bedeutet aber, den Prozess eigenständiger europäischer Sicherheitspolitik zu billigen und dafür auch Leistungen zu erbringen, etwa finanzieller Art.
Die nationalistische Rechte, so die SVP und national-konservative Wirtschaftskreise, haben Volksinitiativen mit verschiedenen Etiketten lanciert, so etwa jene gegen die 10-Millionen-Schweiz und die Kompassinitiative. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie nicht nur jede Annäherung an die EU verhindern, sondern die Schweiz noch stärker von dieser isolieren würden. Eine frühzeitige Annahme der Bilateralen III würde als Signal und völkerrechtliche Verpflichtung diese Obstruktion gegenstandslos machen.
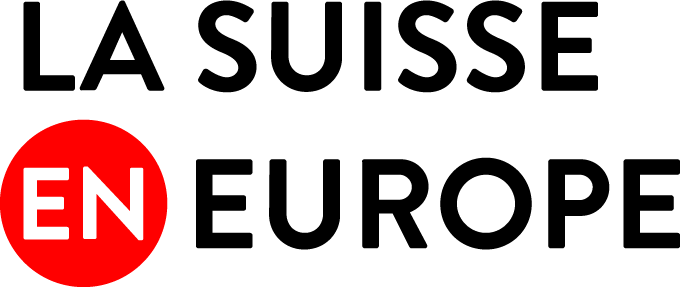





 Keystone/Arno Balzarini
Keystone/Arno Balzarini

